
Konto für Kinder: Was Eltern wissen müssen

Ab wie vielen Jahren darf man ein Bankkonto haben? Das fragen sich oft Eltern, die ihren Nachwuchs für den Umgang mit Geld fit machen wollen. Aber worauf sollen sie achten, wenn sie ein Girokonto für Kinder eröffnen? Welche Unterlagen brauchen sie? Gibt es Zinsen bei einem Kinderkonto? Ist es kostenlos? Und wem gehört das Geld darauf? Mit diesen und ähnlichen Fragen haben sich die KlarMacher beschäftigt. Hier sind die Antworten.
Themen in diesem Artikel
- Was ist ein Kinderkonto?
- Ab wie vielen Jahren darf man ein Bankkonto haben?
- Was ist das beste Konto für Kinder?
- Was braucht man, um ein Kinderkonto zu eröffnen?
- Wem gehört das Geld auf dem Kinderkonto?
- Welche Anlagemöglichkeiten gibt es?
- Fallen bei einem Kinderkonto Steuern an?
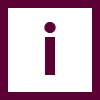
Auf den Punkt
- Eltern können für ein Kind bereits ab dessen Geburt ein Konto eröffnen.
- Minderjährige dürfen nur mit Zustimmung der Eltern oder der Erziehungsberechtigten ein Kinderkonto eröffnen.
- Das Geld auf einem Kinderkonto gehört ausschließlich dem Kind; Eltern dürfen es nicht für eigene Zwecke nutzen.
- Überschreitet das Kapital auf dem Konto für Kinder gewisse Freibeträge, werden darauf Steuern fällig.
Was ist ein Kinderkonto?
Ein Kinderkonto ist ein spezielles Girokonto für Minderjährige, mit dem sie den Umgang mit Geld lernen und frühzeitig finanzielle Erfahrungen sammeln. So können Kinder eigenes Kapital ansparen, selbst verwalten und ausgeben.
Ab wie vielen Jahren darf man ein Bankkonto haben?
Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) sind sehr junge Kinder nicht geschäftsfähig und dürfen deshalb keine rechtskräftigen Verträge abschließen. Das geht erst ab dem siebten Lebensjahr. Dann können Minderjährige Verträge machen – die Eltern müssen aber zustimmen. Das gilt auch für die Eröffnung eines Girokontos für Kinder.
Die Eltern allerdings dürfen jederzeit ein Kinderkonto einrichten – zum Beispiel zur Geburt, um damit beispielsweise Geldgeschenke der Verwandten zu sammeln. Der Nachwuchs unter sieben Jahren darf aber bei den meisten Banken darauf nicht zugreifen.
Bereits berufstätige Jugendliche haben mehr Befugnisse: Konto eröffnen, Geld darauf überweisen lassen oder etwas davon abheben – das ist erlaubt. Aber: Für abgehende Überweisungen oder andere Bankgeschäfte brauchen sie weiterhin die Zustimmung ihrer Eltern.
Und ab wie vielen Jahren können sie allein ein Konto eröffnen – und zwar eins mit allen Rechten? Das ist in der Regel mit der Volljährigkeit möglich, also ab 18 Jahren. Dann gelten sie für den Gesetzgeber als voll geschäftsfähig.
Video: Wer kann einen Vertrag abschließen?
Meine Zustimmung kann ich jederzeit unter Datenschutz widerrufen.
Was ist das beste Konto für Kinder?
Die Antwort hängt maßgeblich von den Bedürfnissen der Kinder (und der Eltern) ab. Soll es nur ein Konto fürs Taschengeld sein oder eine Grundlage für die Altersvorsorge? Danach richtet es sich, welche Bank oder Sparkasse die individuell optimalen Voraussetzungen bietet. Die Regeln der Geldinstitute können sich allerdings von Zeit zu Zeit ändern. Deshalb lohnt es sich vor dem Eröffnen, einen aktuellen Kinderkonto-Vergleich zu machen. Das geht beispielsweise bei Onlineportalen wie Check24 oder Verivox.
Unabhängig von den persönlichen Ansprüchen spielen bei einem Konto für Kinder folgende Punkte eine wichtige Rolle. Es sollte ...
- ... kostenlos sein. Das trifft auf viele Angebote zu, da die Banken Kinder und Jugendliche als potenzielle volljährige Kundschaft ansehen und sie ohne Grundgebühr frühzeitig an sich binden wollen. Trotzdem solltest du die Verträge kontrollieren, weil darin andere Beiträge „versteckt“ sein können. Achtung: Girokonten für Kinder sind nur bis zu einer bestimmten Altersgrenze gratis! Ist die überschritten, erheben viele Institute Gebühren für bis dahin kostenlose Konten. Das passiert oft automatisch
- ... eine Girocard enthalten. Die gehört in den meisten Fällen gratis zum Kinderkonto dazu. Wichtig ist sie beispielweise fürs einfache Abheben von Bargeld am Automaten. Besonders praktisch sind Anbieter mit Geräten an möglichst vielen Standorten. Das Abheben ist bei eigenen Automaten der Banken beziehungsweise der Bankenverbände kostenlos. Bei fremden Instituten können allerdings Gebühren entstehen.
- ... eine Kreditkarte bieten. Auch die gibt es bei vielen Kinderkonten in Form einer Prepaid-Kreditkarte dazu. In manchen Fällen ist sie kostenlos, in anderen wird dafür eine Gebühr fällig.
- ... Zinsen bringen. Diesen Vorteil bieten nur wenige Banken. Und wenn, dann sind die Zinsen sehr gering. Bessere Alternativen sind Sparkonten und Tagesgeldkonten, die manche Geldinstitute speziell für ihre junge Kundschaft anbieten. Nachteil: Gute Zinsen gibt es meist nur auf recht kleine Beträge. Es lohnt sich auch bei einem Kinderkonto, die Zinsen zu vergleichen.
- ... kein Überziehen erlauben. Kinderkonten haben in der Regel keine Überziehungsmöglichkeiten. Die Kinder können also nur so viel Geld ausgeben, wie auf dem Konto ist. Einen Dispositionskredit bekommen nur Volljährige.
- ... digitale Services bieten. Bei vielen Konten ist kostenloses Online Banking per App inklusive. Die Software ist in der Regel auf die junge Kundschaft zugeschnitten. Damit lernt sie leichter, ihre Finanzen digital zu verwalten. Oft können die Eltern digital beobachten, was auf dem Kinderkonto passiert.
Einige der genannten Möglichkeiten und Services sind an Bedingungen geknüpft. So ist Online Banking oft erst ab zwölf Jahren erlaubt. Deshalb sollten sich Eltern erkundigen, was mit dem Kinderkonto in welchem Alter machbar ist.
Das besagt der Taschengeldparagraf
Der Taschengeldparagraf ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für § 110 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Er gewährt Minderjährigen eine gewisse Handlungsfreiheit und Selbstständigkeit bei kleineren Geschäften im Alltag – ohne Zustimmung der Eltern. So muss ein Kind nicht bei jedem Eiskauf um Erlaubnis fragen. Und das Eiscafé muss nicht befürchten, dass die Eltern das Geld zurückfordern. Größere Ausgaben, wie der Erwerb eines Smartphones oder eines Fahrrads, deckt er aber normalerweise nicht. Auch ein Kauf auf Raten ist für Kinder nicht drin.
Was braucht man, um ein Kinderkonto zu eröffnen?
Wenn du ein Kinderkonto (auch „Jugendkonto“ oder „Girokonto für Minderjährige“ genannt) für deine Tochter oder deinen Sohn eröffnen willst, brauchst du einige Unterlagen.
- Personalausweis oder Reisepass der Eltern oder gesetzlichen Vertreter: Beide Elternteile oder die Sorgeberechtigten müssen ihre Identität durch Vorlage eines gültigen Ausweisdokuments belegen.
- Geburtsurkunde des Kindes: Sie ist der Nachweis für das Alter und die Identität des Kindes.
- Personalausweis oder Kinderreisepass des Kindes: Ab einem gewissen Alter, meist ab sieben Jahren, verlangen viele Banken zusätzlich diesen Identitätsnachweis des Kindes.
- Einverständniserklärung der Eltern: Die schriftliche Zustimmung beider Elternteile oder Sorgeberechtigten ist erforderlich, da sie als gesetzliche Vertreter handeln. Das gilt auch nach einer Trennung! Die Zustimmung wird in der Regel direkt bei der Bank erteilt. Bei alleiniger Sorgepflicht reicht das Einverständnis des sorgeberechtigten Elternteils aus. In diesem Fall legst du einen Nachweis über das alleinige Sorgerecht vor (Scheidungsurteil, Sorgerechtsbescheinigung).
- Nachweis des Wohnsitzes: Das kann eine Meldebescheinigung sein oder ein amtliches Schreiben, auf dem die Adresse der Familie vermerkt ist.
Welche dieser Unterlagen für ein Kinderkonto nötig sind, hängt vom jeweiligen Geldinstitut ab. Bei Filialbanken musst du in der Regel einen persönlichen Termin für die Einrichtung vereinbaren.
In vielen Fällen kannst du ein Kinderkonto auch online eröffnen. Dafür gehst du auf die Website der Bank und suchst nach Kinder- oder Jugendkonten. Viele Institute bieten eine spezielle Antragsplattform oder ein Online-Formular an. Dort trägst du die Angaben zur Person des Kindes, der Eltern und zur gewünschten Kontonutzung ein. Anschließend lädst du die erforderlichen Unterlagen hoch.
Im Laufe der Online-Kontoeröffnung muss die Identität der Eltern und des Kindes verifiziert werden. Viele Banken nutzen dazu ein Video-Ident-Verfahren oder das Postident-Verfahren. Oft müssen beide Elternteile ihre Zustimmung zur Kontoeröffnung durch eine digitale Unterschrift oder das Hochladen eines unterschriebenen Dokuments abgeben. Bei manchen Banken geht das auch per E-Mail.
Nach erfolgreicher Überprüfung und Genehmigung bekommst du eine Bestätigung zur Kontoeröffnung per E-Mail oder per Post. In der Regel sind die Kontodaten sowie gegebenenfalls die Zugangsdaten für das Online Banking dabei.

Wem gehört das Geld auf dem Kinderkonto?
Das Geld auf einem Kinderkonto gehört dem Kind, auf dessen Namen das Konto läuft – egal, ob die Eltern es eingezahlt haben, Oma und Opa oder wer auch immer. Da das Kind nicht voll geschäftsfähig ist, verwalten meist die Eltern oder gesetzlichen Vertreter das Konto. Sie können das Geld aber nur im Sinne und Interesse des Kindes verwenden und zum Beispiel Überweisungen machen oder Bargeld abheben.
Eltern dürfen das Geld auf dem Kinderkonto nicht für eigene Zwecke verwenden und damit zum Beispiel das Dach neu decken lassen. Oder verreisen. Damit würden sie das Geld „veruntreuen“ und unter anderem gegen § 1664 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) verstoßen. Um das zu verhindern, haben einige Institute Schutzmaßnahmen. Beispielsweise können sie bei größeren Beträgen eine Genehmigung vom Familiengericht verlangen, bevor sie eine Auszahlung zulassen.

Welche Anlagemöglichkeiten gibt es?
Hier ist es ähnlich wie bei der Auswahl der Bank oder Sparkasse, über die das Kinderkonto läuft. Es hängt davon ab, wie lange das Geld angelegt werden soll, wie hoch die Risikobereitschaft der Eltern ist und welche Ziele mit dem Gesparten erreicht werden sollen.
Hier sind einige Möglichkeiten:
- Tagesgeldkonto: Es eignet sich besonders für kurzfristige Ersparnisse und bietet die Möglichkeit, jederzeit auf das Geld zuzugreifen. Auch gelten hier keine Kündigungsfristen. Die Verzinsung liegt in der Regel über dem Zins des klassischen Sparbuchs.
- Festgeldkonto: Es hat höhere Zinssätze als ein Tagesgeldkonto, allerdings ist das Geld für einen festgelegten Zeitraum gebunden. Sinnvoll kann es sein, wenn das Geld für mehrere Jahre sicher angelegt werden soll (Einlagensicherung), etwa für größere Anschaffungen in der Zukunft oder das spätere Studium.
- Sparbuch: Es bietet sehr niedrige Zinsen (meistens unterhalb der Inflationsrate), ist durch die Einlagensicherung geschützt und in der Regel kostenlos. Größere Sparguthaben lassen sich oft nur nach vorheriger Kündigung nutzen. Das Sparbuch ist geeignet für kleinere Beträge, bei denen es auf maximale Sicherheit und einfache Verwaltung ankommt.
- Fondssparplan: Damit lassen regelmäßig – auch kleinere – Beträge in Investmentfonds oder Exchange Traded Funds (ETFs) anlegen, die auf mehrere Anlageklassen wie Aktien, Anleihen oder Mischfonds setzen. Ein Fondssparplan punktet auf lange Sicht mit potenziell guten Renditeaussichten, weil damit eine breite Risikostreuung möglich ist. Der Anlagehorizont sollte weit sein und mindestens zehn Jahre betragen.
- Aktien: Wer will, kann auch direkt in einzelne Aktien investieren. Auch dann sollte auf eine breite Streuung geachtet werden, um etwaige Verluste von Wertpapieren mit den Gewinnen anderer auszugleichen.
Mehr Wissenswertes zu diesem Thema findest du in unserem Ratgeber „Sparen für Kinder: So geht die Geldanlage für den Nachwuchs“.

Fallen bei einem Kinderkonto Steuern an?
Ja, auch bei einem Kinderkonto können Steuern anfallen. Nämlich dann, wenn mögliche Zinsen und Kapitalerträge gewisse Freibeträge übersteigen. Die folgenden Punkte solltest du deshalb beachten.
- Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge: In Deutschland musst du auf Kapitalerträge, zum Beispiel Zinsen oder Dividenden, eine sogenannte Abgeltungssteuer zahlen. Diese beträgt pauschal 25 Prozent des Gewinns zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer. Auch die Kapitalerträge eines Kinderkontos fallen unter diese Regelung.
- Freibeträge für Kinder: Kinder haben, ebenso wie Erwachsene, einen jährlichen Freibetrag für Kapitalerträge. Das bedeutet, dass Gewinne bis zu dieser Höhe steuerfrei sind. Nur für die Summe oberhalb des Freibetrags wird die Abgeltungssteuer fällig. Allerdings nicht automatisch. Um den sogenannten Sparerpauschbetrag zu nutzen, musst du bei der Bank einen Freistellungsauftrag für das Kinderkonto einreichen.
- Grundfreibetrag: Neben dem Sparer-Pauschbetrag haben Kinder auch einen steuerlichen Grundfreibetrag für ihr Einkommen. Er betrifft nicht nur Kapitalerträge, sondern auch andere Einkünfte des Kindes (wie zum Beispiel aus Ferienjobs). Das bedeutet: Die Einkünfte können auch höher sein als der Sparerpauschbetrag. So lange sie niedriger sind als der Grundfreibetrag, werden trotzdem keine Steuern fällig.
- Nichtveranlagungsbescheinigung (NV-Bescheinigung): Falls absehbar ist, dass die Einkünfte des Kindes (einschließlich Kapitalerträge) den Grundfreibetrag nicht überschreiten werden, können Eltern bei ihrem zuständigen Finanzamt eine Nichtveranlagungsbescheinigung (NV-Bescheinigung) beantragen. Diese Bescheinigung wird der Bank vorgelegt und verhindert, dass die Bank Steuern auf die Kapitalerträge des Kindes erhebt.
Nicht vergessen: Das Kinderkonto und dessen Erträge gehören dem Kind! Die Eltern dürfen dort kein eigenes Geld einzahlen, damit sie bei sich selbst und auch beim Kinderkonto den Grundfreibetrag ausnutzen können. Wenn das Finanzamt das mitbekommt, könnte es das für eine Steuerumgehung halten. In einem solchen Fall darf das Finanzamt die Einkünfte des Kontos den Eltern zurechnen. Diese müssen dann die Steuern nachzahlen.
War der Inhalt für dich hilfreich?
Teile den Artikel:




