
Zinswende: Wann und warum steigen die Zinsen?

Zinsen auf das Gesparte auf dem Tagesgeldkonto? Das gab es lange Zeit nicht. Genauer gesagt seit 2008, als die EZB eine Niedrigzinsphase einläutete, die bis Mitte 2022 andauerte. Seitdem steigen die Zinsen wieder – aber warum hat das so lange gedauert? Wie kam es überhaupt zu dieser Zinswende? Und was bedeutet das Ganze jetzt für Verbraucher*innen? Die KlarMacher erklären es dir.
Themen in diesem Artikel
- Die Niedrigzinsphase von 2008 bis 2022
- Was hat die EZB mit den Zinsen zu tun?
- Was war der Grund für die lange Niedrigzinsphase?
- Die Zinswende 2022: Warum steigen die Zinsen jetzt wieder?
- Was bedeutet die Zinswende für Verbraucher*innen?
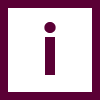
Auf den Punkt
- Von 2008 bis 2022 gab es eine Niedrigzinsphase.
- Grund waren die weltweiten Finanzkrisen sowie die Corona-Pandemie.
- Am 21. Juli 2022 hat die EZB wegen der Inflation eine Zinswende beschlossen. Seitdem steigt der Leitzins wieder.
- Steigende Zinsen bedeuten grundsätzlich, dass Sparen sich mehr lohnt, Kredite aber teurer werden.
Die Niedrigzinsphase von 2008 bis 2022
Bei vielen Geldgeschäften gehören Zinsen dazu. Vor allem bei Krediten und Sparanlagen. Ein wesentliches Merkmal von Zinsen: Manchmal steigen sie an, manchmal sinken sie. Eine ganze Zeit lang – nämlich von 2008 bis 2022 – waren sie sogar auf einem so geringen Niveau, dass von einer Niedrigzinsphase gesprochen wurde.
Über den Begriff „Phase” lässt sich allerdings streiten, jedenfalls wenn man ihn als vorübergehenden Zeitabschnitt versteht. Schließlich hielt diese Periode einige Jahre lang an. Mittlerweile ist sie aber vorbei.
Woran liegt das? Die kurze Antwort: Die Zinsen steigen wieder, wenn die Europäische Zentralbank (EZB) das so will. Und die lange Antwort? Die verraten wir dir im weiteren Text.
Das sind Zinsen
Zinsen sind eine Gebühr für geliehenes Geld. Die musst du zum Beispiel einer Bank für einen Kredit geben, den du bei ihr aufnimmst. Aber es geht auch andersrum: Wenn du beispielsweise Geld in einen Sparvertrag einzahlst, dann bekommst du dafür von der Bank Zinsen. Wie hoch die Zinsen sind, hängt vom jeweiligen Zinssatz ab. Der wird in Prozent angegeben und zeigt, wie hoch der Anteil der Zinsen an dem Gesamtbetrag des geliehenen oder angelegten Geldes ist. Hier ein stark vereinfachtes Beispiel:
Angenommen, du nimmst einen Kredit über 1.000 Euro bei einer Bank auf. Diese verlangt dafür einen Zinssatz von fünf Prozent. Fünf Prozent von 1.000 Euro sind 50 Euro. Diese 50 Euro sind die Zinsen, die du zusätzlich zu den geliehenen 1.000 Euro zurückzahlen musst. Anders ausgedrückt: Der Kredit von 1.000 Euro kostet dich 50 Euro an Zinsen.
Was hat die EZB mit den Zinsen zu tun?
Die Europäische Zentralbank in Frankfurt am Main legt das allgemeine Zinsniveau fest. Und zwar für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion und deren jeweilige Zentralbanken – darunter die Deutsche Bundesbank. Dabei lässt sich die EZB von der allgemeinen wirtschaftlichen Situation leiten. Grundsätzlich gilt dabei: Ist die wirtschaftliche Lage gut, hebt sie die Zinsen an. Ist die Lage schlecht, senkt sie die Zinsen. Was zur Zinswende 2022 geführt hat, steht weiter unten im Text.
Damit hat die EZB große geld- und wirtschaftspolitische Macht. Das bekommen alle Menschen in der Währungsunion zu spüren. Vor allem, wenn sie Geld anlegen oder aufnehmen wollen:
- Sind die Zinsen niedrig, kosten Kredite weniger. Gleichzeitig wirft Vermögen auf Sparbüchern, Tagesgeldkonten und Co. weniger ab.
- Sind die Zinsen hoch, macht das Kredite teurer. Andererseits bekommen Sparer*innen mehr für ihr Geld auf der hohen Kante.
Die Zinspolitik der EZB ist also immer eine zweischneidige Sache – mal ist sie für Sparer*innen günstig, mal für Kreditnehmer*innen. Und umgekehrt.

Die EZB besitzt vor allem drei Zins-Werkzeuge:
Leitzins
Der Leitzins ist der Zins, zu dem sich die Deutsche Bundesbank und alle anderen Geldinstitute in Deutschland bei der EZB Geld leihen. Diese reichen den Zinssatz wiederum an ihre Kund*innen weiter.
Damit bestimmt der Leitzins der EZB am Ende, was dich persönlich ein Kredit kostet. Zwar entscheidet deine Bank selbst, wie viel sie dir für ein Darlehen berechnet. Doch sie wird sich dabei am Leitzins orientieren. Das gilt auch umgekehrt für die Zinsen, die du für dein Erspartes bekommst. Übrigens: Der Leitzins heißt in Fachkreisen Zinssatz für das Hauptrefinanzierungsgeschäft.
In der Niedrigzinsphase lag der Leitzins über Jahre hinweg bei 0,0 Prozent. In dieser Phase war es also besonders günstig, Kredite aufzunehmen, aber Geld auf Sparbüchern brachte keine Gewinne ein.
Einlagenzins
Den Einlagezins bekommen Banken, wenn sie ihr Geld vorübergehend auf einem Konto der EZB zwischenlagern. Man nennt das auch parken. Das ist so, als würdest du deine Euros auf dem Girokonto liegen lassen, um in Ruhe zu überlegen, was du damit machen willst. Die Niedrigzinsphase hatte auch Auswirkungen auf den Einlagenzins: Seit 2019 erhielten Banken keinen Einlagezins mehr, sondern mussten ihn stattdessen bezahlen. Und zwar an die EZB, die das so entschieden hatte. Der Volksmund nennt den Einlagenzins auch Strafzins.
Wann müssen Verbraucher*innen Strafzinsen zahlen?
Den Einlagenzins fordert die EZB für das Geld, das die Banken in einer Niedrigzinsphase bei ihr parken. Viele Geldhäuser wollen dann auf den Kosten nicht sitzen bleiben und reichen sie als „Verwahrentgelt” an ihre Kundschaft weiter. Die nennt das dann meist Strafzinsen, Negativzinsen oder Minuszinsen. So ein Verwahrentgelt verlangen Banken bei Sparguthaben (oder ähnlichen Anlageformen) beispielsweise ab einer Höhe von 10.000 Euro, 50.000 Euro oder 100.000 Euro. Das heißt oft, dass sich das Kapital der Anleger*innen verringert, anstatt sich zu vermehren. Vorreiter war 2017 die Volksbank Reutlingen, die schon für den ersten gesparten Euro 0,5 Prozent Strafzinsen erhob.
Das Ende der Niedrigzinsphase bedeutet, dass Banken aktuell keine Strafzinsen mehr an die EZB bezahlen und diese auch nicht mehr an ihre Kund*innen weiterreichen.
Doch warum parken Banken Geld bei der EZB? Dazu müssen wir etwas ausholen: Manchmal haben Banken mehr Geld, als sie im Moment brauchen. Das kann zum Beispiel sein, wenn gerade kaum jemand einen Kredit aufnehmen will. Was machen die Banken dann mit dem überschüssigen Kapital? Im Idealfall legen sie es selbst gewinnbringend an, indem sie zum Beispiel Wertpapiere kaufen. Das bietet sich aber nicht immer an. Dann wählen Banken oft die EZB als Zwischenlager.
Und das funktioniert so: Jede Bank muss ein EZB-Konto haben. Allein schon deshalb, um darauf ihre finanziellen Reserven zu lagern. Dieses Geld braucht sie in der Hinterhand, damit sie flüssig (liquide) ist. Beispielsweise, um ihren Kund*innen kurzfristig und jederzeit Kreditwünsche erfüllen zu können. Hat eine Bank am Ende eines Tages noch diese Reserven oder andere Gelder übrig, dann bleiben die automatisch auf ihrem Konto bei der EZB.
Spitzenrefinanzierungssatz
Allerdings kann das EZB-Konto einer Bank abends auch mal ins Minus geraten. Dann muss sie den Fehlbetrag schnell ausgleichen. Zu diesem Zweck leiht sich das Unternehmen über Nacht Geld von der Zentralbank. Die erhebt dafür zusätzlich zum Leitzins eine Art Kreditzins. Das ist der sogenannte Spitzenrefinanzierungssatz und damit quasi ein weiterer Strafzins, den die EZB von den Banken fordert.
Da es sich aber um einen kurzfristigen Zins handelt, wirkt sich der Spitzenrefinanzierungssatz nicht so sehr auf Verbraucher*innen aus wie der Leitzins.

Was war der Grund für die lange Niedrigzinsphase?
Du siehst: Die Antwort auf die Frage „Wann steigen die Zinsen?” hängt entscheidend von der Europäischen Zentralbank ab. Und die hielt viele Jahre bei der Zinsentwicklung den Daumen drauf. Aber warum eigentlich?
Die lange Niedrigzinsphase lag zu einem großen Teil an der globalen Finanz-, Schulden- und Währungskrise. Deren Höhepunkt war zwischen 2007 und 2009. Im Herbst 2008 ging mit Lehman Brothers sogar eine US-Großbank von internationalem Format pleite. Das war bis dahin kaum denkbar und für die Finanzbranche ein Schock. Nicht zuletzt deswegen brachen global die Aktienkurse ein. Die Unsicherheit an den Geldmärkten dauerte in den Jahren danach an. Auch aufgrund der Corona-Pandemie, die ebenfalls für erhebliche wirtschaftliche Turbulenzen sorgte. In der Folge schwächelt weiterhin weltweit die Konjunktur.
Um die Konjunktur nicht weiter einbrechen zu lassen, senkte die EZB die Leitzinsen seit 2008 nach und nach von 4,25 Prozent auf 0,0 Prozent. Damit wollte sie Kredite billiger machen und so die Unternehmen zu Investitionen anregen, was zu mehr Umsatz und Gewinn führen sollte.
Ein zweiter wesentlicher Anlass für die Niedrigzinsphase war die hohe Staatsverschuldung vieler Länder. Die kostet viele Kreditzinsen. Damit diese die Staatskassen nicht zu stark belasten, schraubte die EZB die Zinsen extrem herunter.

Die Zinswende 2022: Warum steigen die Zinsen jetzt wieder?
Während der Niedrigzinsphase hieß es oft, dass die EZB den Leitzins wieder anheben würde, wenn die wirtschaftliche Lage sich von den Krisen erholt hat. Nun können wir aktuell nicht behaupten, dass wir keine großen Krisen mehr hätten – eher im Gegenteil. Deswegen müssen wir jetzt noch einmal ein bisschen ausholen. Eine der Krisen ist nämlich der Grund, warum die EZB den Leitzins erhöht hat: die Inflation.
Was können höhere Zinsen gegen steigende Preise ausrichten? Grundsätzlich geht es hier um das Gegenstück der niedrigen Zinsen und günstigen Kredite, die in der Niedrigzinsphase die Wirtschaft ankurbeln sollten: Wenn die Zinsen steigen und damit die Kredite teurer werden, wird weniger investiert und auch weniger gekauft. Dadurch sinkt die Nachfrage und die Preise gehen runter.
Und genau deswegen hat die EZB den Leitzins seit Juli 2022 schrittweise wieder angehoben – von 0,0 Prozent bis aktuell 4,25 Prozent (Stand: August 2023). Und die Inflation? Ist immer noch ein Problem. Höhere Leitzinsen haben nämlich nicht sofort, sondern erst mittelfristig eine Auswirkung. Im Juni 2023 lag die Inflationsrate bei 6,4 Prozent. Das sind zwar weniger als die 10,4 Prozent im Oktober 2022, aber immer noch deutlich mehr als die angestrebten 2 Prozent.
Was bedeutet die Zinswende für Verbraucher*innen?
Wie sieht es nun aus mit der herkömmlichen Weisheit, dass höhere Zinsen schlecht für Kreditnehmer*innen und gut für Sparer*innen sind? Das ist auch ein bisschen kompliziert.
Schauen wir uns zuerst Kredite an. Die sind in der Tat teurer geworden. Wer heute ein Haus bauen oder einen Immobilienkredit umschulden möchte, muss also mit höheren Zinsen und höheren Gesamtkosten für die Immobilienfinanzierung rechnen. Mehr zu der Frage, mit wie viel Geld du bei einem Kredit rechnen kannst, erfährst du im KlarMacher-Ratgeber „Kredit: Bekomme ich genug für meinen Traum?“
Und was ist mit Sparer*innen? Lohnt es sich jetzt endlich wieder, ein Tagesgeldkonto zu haben? Jein. Es gibt mittlerweile zwar keine Strafzinsen mehr, aber längst nicht alle Banken haben die höheren Zinsen an ihre Kund*innen weitergegeben. Sollte dein Tagesgeldkonto noch bei 0,0 oder 0,5 Prozent Zinsen festhängen, schau dich doch einmal um, ob du bei einer anderen Bank ein besseres Angebot erhältst, zum Beispiel mit dem TagesGeld der Hanseatic Bank.
Zu guter Letzt ein Blick in die Zukunft: Wie geht es weiter? Steigen die Zinsen jetzt immer weiter oder kommt bald die nächste Niedrigzinsphase? Das weiß niemand. Unser Rat: Verfolge aufmerksam, was die EZB bei ihren Treffen beschließt. Oft berichten die Medien schon vorher über eventuelle Tendenzen.
War der Inhalt für dich hilfreich?
Teile den Artikel:




