
Wächterin des Euro: Diese Aufgaben hat die EZB

Was macht die EZB, die Europäische Zentralbank? Richtig, irgendwas mit Geld und Europa. Aber was genau? Die KlarMacher zeigen dir, warum es die EZB gibt und sie für rund 341 Millionen Menschen auf diesem Kontinent wichtig ist. Auch für dich. Die Zentralbank bestimmt nämlich, wie viel Zinsen du für einen Kredit bezahlen musst oder was dein Einkauf im Supermarkt kostet. Welche Aufgaben hat die EZB außerdem? Das und mehr erfährst du hier.
Themen in diesem Artikel
- 20 Länder, eine Bank: Die Europäische Zentralbank
- Das Hauptziel der EZB: Preisstabilität durch moderate Preissteigerung
- Erstes Instrument: Leitzinsen
- Zweites Instrument: Mindestreserve
- Drittes Instrument: Offenmarktgeschäfte
- Weitere Aufgabe der EZB: Kontrolle des Bankensystems
- Weitere Aufgaben der EZB rund um den Wechselkurs und mehr
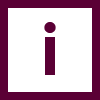
Auf den Punkt
- Die Europäische Zentralbank steuert die Geldpolitik für die 20 EU-Länder, die den Euro als Währung nutzen.
- Als Bank der Banken macht sie keine Geschäfte mit Privatleuten.
- Sie sorgt in der Eurozone vor allem für die Stabilität der Währung und damit der Preise.
- Außerdem bestimmt sie unter anderem die Höhe der Zinsen für Kredite und Geldanlagen.
20 Länder, eine Bank: Die Europäische Zentralbank
Der Euro ist für viele Menschen inzwischen Alltag. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass Tourist*innen vor Auslandsreisen etwa noch D-Mark in italienische Lira oder griechische Drachmen umtauschen mussten.
1999 startete die europäische Gemeinschaftswährung, also der Euro, gleichzeitig in elf Staaten. Zu Beginn aber nur als sogenanntes Buchgeld für Banken. Die Bürger*innen konnten ihn damals noch nicht in die Hand nehmen und damit zum Beispiel im Supermarkt bar bezahlen. Das ging erst 2002, als der Euro zur klingenden Münze (und zu Scheinen aus Papier) wurde. Mittlerweile haben 20 EU-Staaten die neue Währung eingeführt und bilden zusammen die sogenannte Eurozone mit 341 Millionen Menschen.
Das ist nach den USA der zweitgrößte Wirtschaftsraum der Welt. Ein gemeinsames Zahlungsmittel für diese Zone setzt eine gemeinsame Geldpolitik voraus, die unter anderem den Wert der Währung sichert. Genau diese Aufgabe übernimmt die Europäische Zentralbank, kurz die EZB. Sie ist seit dem 1. Juni 1998 die Währungsbehörde der Euroländer.
Übrigens: Wo du überall mit dem Euro bezahlen kannst, erfährst du im KlarMacher Ratgeber „Welche Länder haben den Euro? Und wo musst du Geld tauschen?“.
Die Europäische Zentralbank (EZB) in Kürze
- Währungsbehörde der Mitgliedstaaten der Eurozone mit Sitz in Frankfurt am Main
- Sitz der EZB ist Frankfurt am Main
- Gegründet 1998
- Präsidentin Christine Lagarde
- Oberstes Beschlussorgan: EZB-Rat
- Mehr als 3.500 Mitarbeiter*innen
- Politisch und kommerziell unabhängig
- Aufgaben: Preisstabilität, Wirtschaftswachstum, Bankenaufsicht, Koordination der Banknotenausgabe
Im Auftrag der Europäischen Union (EU) überwacht die EZB die Geldmenge, die in der Eurozone im Umlauf ist. Damit hat die EZB eine wichtige Aufgabe. Gibt es nämlich zu viele Euromünzen und -scheine, dann verringert sich deren Wert und die Preise steigen – es kommt zur sogenannten Inflation. Wird hingegen zu wenig Geld geprägt oder gedruckt, passiert das Gegenteil – die Deflation. Im Übermaß ist beides für eine Volkswirtschaft nicht gut.
Die EZB ist keine Bank für Privatleute, sondern sozusagen die Bank der Banken im Euroraum. Nur sie können dort Geld leihen und/oder anlegen.
Sie ist zwar politisch unabhängig, darf aber trotzdem nicht tun und lassen, was sie möchte. Sie muss über ihr Handeln Rechenschaft vor dem Europäischen Parlament ablegen. Das muss sein, weil die Politik der EZB alle Euroländer betrifft. Die Herausforderung: Die wirtschaftliche Lage ist in den 20 Staaten sehr unterschiedlich. Das macht den Job der EZB in Frankfurt nicht leicht.
Europäische Zentralbank (EZB) in 3 Minuten erklärt
Meine Zustimmung kann ich jederzeit unter Datenschutz widerrufen.
Das Hauptziel der EZB: Preisstabilität durch moderate Preissteigerung
Die wichtigste Aufgabe und Hauptziel der EZB ist die Sicherung der Preisstabilität im Euroraum. Was heißt das? Einfach erklärt: Unter Preisstabilität versteht die EZB, dass die Preise für alltägliche Waren jedes Jahr stetig leicht ansteigen – um etwas weniger als zwei Prozent. Der Grund für diese gewollte Inflationsrate ist ein psychologischer Effekt: Bei dauernd sinkenden Preisen kaufen die Menschen eher weniger. Sie hoffen nämlich, dass sie ein Produkt noch günstiger bekommen, wenn sie etwas warten. Das ist politisch nicht gewollt. Denn nur, wenn gekauft und investiert wird, wächst die Wirtschaft.
Die zweite Hauptaufgabe ist die Unterstützung der Wirtschaftspolitik der Europäischen Union – aber ausdrücklich nur dann, wenn das Ziel der Preisstabilität nicht gefährdet ist. Um diesen Aufgaben nachzukommen, nutzt die Europäische Zentralbank mehrere Instrumente, die wir uns im Folgenden genauer anschauen.

Erstes Instrument: Leitzinsen
Das wichtigste und sicherlich auch bekannteste Werkzeug sind die Leitzinsen. Regelmäßig wird in den Nachrichten darüber berichtet, ob und wie die EZB bei ihren – meist monatlichen – Sitzungen diese Zinsen verändert. Damit legt sie einerseits fest, was die nationalen Zentralbanken bezahlen müssen, wenn sie sich bei ihr Geld leihen. Und andererseits, welchen Zinssatz diese Banken bekommen, wenn sie Geld bei der EZB anlegen möchten. Das hat für viele Bürger*innen im Euroraum Folgen.
Zwar bestimmt die EZB nicht direkt die Zinsen, die du für einen Kredit bezahlen musst oder die du auf das Geld auf deinem Tagesgeldkonto erhältst – das macht deine Bank. Doch diese orientiert sich am Leitzins der EZB. So beeinflusst die Entscheidung der EZB letztlich die Volkswirtschaften und Menschen in den Euroländern. Auf die häufige Frage, wann und warum die Zinsen steigen, lautet die Antwort also: Weil die EZB den Leitzins erhöht hat.
Mehr Informationen über den Leitzins findest du leicht erklärt im KlarMacher Ratgeber: „Was ist der Leitzins? Und was hat der mit mir zu tun?“.
Entspann dich! Die Zinsen kommen von allein.
Mit einem SparBrief der Hanseatic Bank blickst du entspannt nach vorn. Denn dein Geld ist sicher angelegt. Und bringt kräftig Zinsen. Da wartet man doch gern.

Zweites Instrument: Mindestreserve
Mit der Mindestreserve verpflichtet die EZB Geschäftsbanken dazu, einen Anteil des bei ihnen angelegten Kapitals als Sicherheit bei den jeweiligen Nationalbanken zu hinterlegen. Dieser Mindestreservesatz liegt bei einem Prozent (Stand: Oktober 2023). Zum Beispiel: Du hast 100 Euro auf einem Tagesgeldkonto bei Ihrer Bank. Dann muss deine Bank einen Prozent davon, also einen Euro bei der Deutschen Bundesbank einzahlen. Deine Bank kann in dem Fall nicht mit deinen gesamten 100 Euro arbeiten, sondern nur mit 99 Euro.
Drittes Instrument: Offenmarktgeschäfte
Wie Privatpersonen und Unternehmen brauchen auch Länder hin und wieder mehr Geld, als sie gerade haben. Dann müssen sie dafür Schulden machen. Zu diesem Zweck geben sie beispielsweise Staatsanleihen heraus. Die können Anleger*innen kaufen und bekommen dafür nach einer vereinbarten Zeit von dem jeweiligen Staat ihr Kapital plus Zinsen zurück.
Hier kann die EZB einspringen und solche Papiere erwerben. In dem Fall spricht man von einem Offenmarktgeschäft. Die EZB wirft mit diesen Offenmarktgeschäften frisches Geld auf den Markt, erhöht die Geldmenge und kurbelt im Idealfall die Wirtschaft des kriselnden Lands an.
Diese Anleihekäufe sind nicht unumstritten. Das Problem: Eigentlich darf die EZB Staaten nicht direkt finanzieren. Es gab daher viel Kritik, als die EZB während der europäischen Finanzkrise zu diesem Mittel griff und Staatsanleihen im Wert von mehr als zwei Billionen Euro aufkaufte. Sie rechtfertigte sich damit, auf diese Weise den Euroraum zu stabilisieren.

Weitere Aufgabe: Kontrolle des Bankensystems
Die Bankenkrise erwischte auch zahlreiche Geldinstitute in Europa – sie mussten letzten Endes mit Steuergeldern gestützt werden. Um das künftig zu vermeiden, bekam die EZB 2014 eine zusätzliche Aufgabe: die Kontrolle über alle Banken, die in der gesamten EU – also nicht nur in der Eurozone – tätig sind.
Konkret legt sie Leitlinien für rund 120 große Banken fest und achtet darauf, dass sie in ganz Europa gleich angewendet werden. Im eng miteinander verflochtenen europäischen Bankensystem sorgt das für mehr Stabilität. Damit soll auch das Vertrauen der Bürger*innen und Unternehmen in den Sektor gestärkt werden.
Weitere Aufgaben der EZB rund um den Wechselkurs und mehr
Neben den geschilderten Hauptaufgaben hat die EZB aber noch mehr zu tun:
- Sie hält und verwaltet die offiziellen Währungsreserven der Euroländer.
- Sie kauft und verkauft Währungen, um Wechselkurse im Gleichgewicht zu halten.
- Sie veröffentlicht jeden Werktag einen Referenzkurs für die Wechselkurse zwischen dem Euro und anderen Währungen wie dem US-Dollar und vielen anderen.
- Sie fördert ein reibungsloses Funktionieren der Zahlungssysteme.
- Sie erstellt Statistiken und Zentralbankbilanzen.
War der Inhalt für dich hilfreich?
Teile den Artikel:




