
Definition: Was ist ein Minijob?

Bei Reinigungsdiensten, Saisonarbeit, in der Gastronomie, im Handwerk und in vielen anderen Berufsfeldern sind Minijobs beliebt. Und vom Minijob hat jede*r schon mal was gehört. Doch was genau unterscheidet diese Art von Job von anderen? Welche Vor- und Nachteile haben Minijobber*innen gegenüber den „normalen” Angestellten? Wir machen klar, worauf es beim Minijob ankommt.
Themen in diesem Artikel
- Was unterscheidet einen Minijob von anderen Jobs?
- Was ist der Unterschied zwischen dem 556-Euro-Minijob und dem kurzfristigen Job?
- Versicherungen und Minijob: Wer ist wie und wo versichert?
- Arbeitsrecht: Was steht Minijobber*innen zu?
- Was gilt beim Minijob für Bürgergeld, Arbeitslose und Rentner*innen?
- Mehrere Minijobs oder ein Minijob als zusätzliche Beschäftigung
- Wie wird der Minijob besteuert?
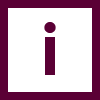
Auf den Punkt
- Es gibt zwei Arten von Minijob: den 556-Euro-Minijob und den kurzfristigen Minijob.
- Minijobber*innen müssen keine Beiträge in die Sozialversicherung einzahlen – zumindest nicht von ihrem Lohn.
- 556-Euro-Minijober*innen können sich von der Rentenversicherungspflicht befreien lassen. Kurzfristig Beschäftigte sind nicht rentenversichert.
- Bei der Ausübung von mehreren Minijobs gelten spezielle Regelungen hinsichtlich der Sozialversicherungspflicht und der Steuern.
- Volljährige Minijobber*innen haben in der Regel Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn und bezahlte Urlaubstage.
- Arbeitsgeber müssen für Minijobber*innen Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung zahlen, aber nicht zur Arbeitslosenversicherung.
Was unterscheidet einen Minijob von anderen Jobs?
Wie es der Name schon verrät, ist der Minijob kein klassischer Voll- oder Teilzeitjob. Dennoch ist Minijob nicht gleich Minijob: Zum einen gibt es den 556-Euro-Minijob – auch als geringfügige Beschäftigung bekannt. Zum anderen gibt es den sogenannten kurzfristigen Minijob beziehungsweise die kurzfristige Beschäftigung.
Der gemeinsame Unterschied bei den beiden Minijobarten zu anderen Jobs ist, dass die Minijobber*innen keine Sozialversicherungsbeiträge zahlen. Das gilt aber nicht für die Arbeitgeber. Sie zahlen für geringfügig oder kurzfristig Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung.
Übrigens: Wenn jemand einen Minijob ausübt, heißt es oft, dass die Person auf Minijob-Basis angestellt ist oder – weniger geläufig – auf gfB-Basis (geringfügige-Beschäftigung-Basis).
Beschäftigung im privaten Haushalt
Wenn Minijobber*innen in einem privaten Haushalt angestellt sind, profitieren die Arbeitgeber von niedrigeren Abgaben und Steuerermäßigungen – vorausgesetzt, es handelt sich um eine haushaltsnahe Tätigkeit wie zum Beispiel Kinderbetreuung, Gärtnern oder Saubermachen. Mehr zu Steuervorteilen liest du in dem Ratgeber „Steuer: Was kann ich absetzen?”.
Was ist der Unterschied zwischen dem 556-Euro- und dem kurzfristigen Minijob?
Am 1. Januar 2025 wurde die Verdienstgrenze von 538 Euro auf 556 Euro erhöht – weil dann auch der gesetzliche Mindestlohn angehoben wurde. Für den 556-Euro-Minijob gilt – wie der Name es schon verrät – eine Verdienstgrenze von 556 Euro pro Monat – im Fachjargon ist die Rede von der Geringfügigkeitsgrenze. 12 mal 556 Euro sind 6.672 Euro pro Jahr. Wer über diese Summe hinaus verdient, ist in der Regel sozialversicherungspflichtig und es ist kein Minijob mehr. Bei einem monatlichen Lohn zwischen 556,01 Euro und 2.000 Euro handelt es sich dann um einen sogenannten Midijob.
Beim kurzfristigen Minijob hingegen ist nicht der Lohn begrenzt, sondern die Arbeitszeit: Höchstens 70 Tage oder drei Monate am Stück dürfen kurzfristige Minijobber*innen arbeiten.
Mehr zu dem Thema liest du in unserem Ratgeber „Welche Grenzen gelten für Minijobs?”.

Versicherungen und Minijob: Wer ist wie und wo versichert?
Was bedeutet es konkret, dass du als Minijobber*in keine Sozialversicherungsbeiträge zahlen musst? Zu den Sozialversicherungen gehören in Deutschland:
- Rentenversicherung
- Krankenversicherung
- Pflegeversicherung
- Unfallversicherung
- Arbeitslosenversicherung
Die Sozialversicherungsfreiheit wirkt sich unterschiedlich auf 556-Euro-Minijobber*innen und kurzfristige Minijobber*innen aus: Kurzfristig Beschäftigte sind weder renten- noch krankenversichert. Bei den 556-Euro-Minijobber*innen sieht es zum Teil anders aus.
556-Euro-Minijob und Rentenversicherung
Seit 2013 sind die geringfügig Beschäftigten in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert. Widerspricht das nicht der oben erwähnten Sozialversicherungsfreiheit? Nicht ganz! Denn du kannst dich als 556-Euro-Minijobber*in von der Rentenversicherung befreien lassen. Dazu stellst du einen Antrag – zum Beispiel mit diesem Formular – und gibst es deinem Arbeitgeber. Bedenke aber: Dann kannst du mit dem geringfügigen Job deine Rente nicht aufstocken.
Minijob: 3 wichtige Warnungen
Meine Zustimmung kann ich jederzeit unter Datenschutz widerrufen.
556-Euro-Minijob und Krankenversicherung
Die Auftraggeber zahlen zwar pauschale Beiträge für ihre Minijobber*innen in die gesetzliche Krankenversicherung, aber nicht für die private und ebenfalls nicht für die Pflegeversicherung. Diese Beiträge gehen an die Minijob-Zentrale. Aber: Wer nur einen 556-Euro-Job hat, ist damit nicht automatisch krankenversichert. Viele Minijobber*innen sind aber aus anderen Gründen krankenversichert, zum Beispiel, weil sie einen sozialversicherungspflichtigen Hauptberuf haben oder familienversichert sind. Falls nicht, Betroffene müssen sie sich selbst krankenversichern.
Und wie sieht es im Falle einer Arbeitsunfähigkeit aus? Für sechs Wochen bist du auf der sicheren Seite, denn so lange muss dein Arbeitgeber den Lohn weiterzahlen. Danach aber ist Schluss, denn anders als klassische Angestellte bekommst du kein Krankengeld. Es sei denn, du gehst zusätzlich einer sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit nach.
Außerdem stehen Minijobber*innen auch die Kinderkrankentage zu – bei Kindern bis zum zwölften Lebensjahr oder einem Kind mit Behinderung.
Mutterschaftsgeld gibt es ebenfalls für Minijobber*innen von der gesetzlichen Krankenversicherung. Wer aber in der Familien- oder Privatversicherung ist, bekommt maximal 210 Euro vom Bundesamt für Soziale Sicherung.
Übrigens: Dein Einkommen aus dem Minijob wird bei der Berechnung des Elterngeldes berücksichtigt.
Minijob und Unfallversicherung
Die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung sind für alle Arbeitgeber verpflichtend. Somit sind Minijobber*innen – kurzfristige und geringfügige – bei Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und Unfällen auf dem Weg zu Arbeit abgesichert. Inwiefern? Das kommt darauf an. Zu den Leistungen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) gehören...
- Übernahme von Behandlungs-, Pflege- und Transportkosten.
- Zahlung von Überbrückungs- oder Verletztengeld oder der Erwerbsminderungsrente.
Minijob und Arbeitslosenversicherung
Weder dein Arbeitgeber noch du als Minijobber*in zahlst in die Arbeitslosenversicherung ein. Deshalb ergeben sich aus der geringfügigen oder kurzfristigen Beschäftigung keine Ansprüche auf Arbeitslosengeld.

Arbeitsrecht: Was steht Minijobber*innen zu?
556-Euro-Minijobber*innen haben fast die gleichen Rechte wie andere Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigte. Wohlgemerkt: Das gilt nicht für kurzfristige Minijobs und geringfügige Beschäftigungen im privaten Haushalt. In der Praxis sieht es unter Umständen anders aus. Es gibt Arbeitgeber, die ihren geringfügig Angestellten ihre Rechte verwehren. Deswegen: Prüfe deinen Minijob-Arbeitsvertrag gründlich, bevor du ihn unterschreibst.
Kündigungsfrist im Minijob
Für Minijobber*innen gilt nach dem Ablauf der Probezeit die gesetzliche Kündigungsfrist von vier Wochen – und zwar zum 15. oder zum Ende eines Kalendermonats. Diese Frist müssen ebenfalls die Arbeitgeber berücksichtigen. Wenn das Arbeitsverhältnis schon länger als zwei Jahre besteht, gelten für die Arbeitgeber längere Fristen:
- 2–5 Jahre: 2 Monate Kündigungsfrist
- 5–8 Jahre: 3 Monate Kündigungsfrist
- 8–10 Jahre: 4 Monate Kündigungsfrist
- 10–12 Jahre: 5 Monate Kündigungsfrist
- 12–15 Jahre: 6 Monate Kündigungsfrist
- über 15 Jahre: 7 Monate Kündigungsfrist
Während der Probezeit dürfen beide Seiten – die Arbeitgeber und die geringfügig Beschäftigten – mit einer Frist von zwei Wochen kündigen.
Es gibt aber zwei Ausnahmen. Die gesetzlichen Fristen gelten nicht unbedingt, wenn ...
- das Arbeitsverhältnis aus einem wichtigen Grund nicht fortgeführt werden kann.
- der Betrieb weniger als zehn Angestellte hat.
- der Betrieb weniger als fünf Angestellte hat – das gilt aber nur für die Minijobber*innen, die ihre Tätigkeit bereits seit dem 31. Dezember 2003 oder früher ausüben.
Wie berechnest du den Urlaubsanspruch im Minijob?
Wie viele Urlaubstage dir zustehen, hängt von der Anzahl deiner Arbeitstage pro Woche ab. So berechnest du deinen individuellen Urlaubsanspruch: Anzahl der Arbeitstage pro Woche mal Urlaubsanspruch in Werktagen. Das Ergebnis teilst du dann durch die übliche Wochenarbeitszeit von fünf oder sechs Tagen. Oder du nutzt den Online-Urlaubsrechner von der Minijob-Zentrale.
Rechenbeispiel: Angenommen, du hast pro Jahr Anspruch auf 24 Urlaubstage – das ist dein Urlaubsanspruch in Werktagen – und arbeitest an drei Tagen pro Woche im Minijob. Das sind dann 3 × 24 = 72. Für die Angestellten in der Firma sind sechs Arbeitstage üblich. Deswegen teilst du die 72 durch 6. Daraus ergibt sich dein Urlaubsanspruch von 12 Tagen im Jahr.
Übrigens: Minijobber*innen haben nicht nur Anspruch auf bezahlte Urlaubstage, sondern auch auf bezahlte Feiertage – wenn ihr regulärer Arbeitstag auf einen fällt.

Mindestlohn und Minijob
Der gesetzliche Mindestlohn von 12,82 Euro gilt auch für alle Minijobber*innen ab 18 Jahren. Ausnahmen gelten in der Regel nur für Auszubildende, Ehrenamtliche, Schüler*innen und Praktikant*innen. (Stand: 2025)
Was gilt beim Minijob für Bürgergeld, Arbeitslose und Rentner*innen?
Wenn du Arbeitslosengeld oder Bürgergeld (ehemals Hartz IV) bekommst, gilt für dich die Obergrenze von 556 Euro nicht. Vielleicht behält das Jobcenter oder Arbeitsamt schon bei weniger Einkommen einen Teil deines Verdienstes. Denn für dich gibt es eine individuelle Einkommensgrenzen. Wie hoch die in deinem Fall ist, erfährst du bei deinem Arbeitsamt oder Jobcenter.
Als Rentner*in hingegen musst du dir keine Sorgen um eine Kürzung deiner Rente machen – du kannst unbegrenzt hinzuverdienen. Seit dem ersten Januar 2023 gibt es auch die sogenannte Hinzuverdienstgrenze für Frührentner*innen nicht mehr. Dennoch gilt die Geringfügigkeitsgrenze für alle geringfügig Beschäftigten, ob in Rente oder nicht: Der Minijob ist nur bei einem Verdienst bis zu 6.672 Euro im Jahr sozialversicherungsfrei.
Mehrere Minijobs oder ein Minijob als zusätzliche Beschäftigung
Wer neben dem Minijob noch einer sozialversicherungspflichtigen Hauptbeschäftigung nachgeht, braucht für den Minijob eine Erlaubnis vom Hauptarbeitgeber. Ein Minijob neben dem Hauptjob ist sozialversicherungsfrei. Aber der zweite Minijob, der parallel zum Hauptjob ausgeübt wird, ist dann sozialversicherungspflichtig – unabhängig vom Verdienst.
Wie sieht es denn aus, wenn du mehrere Minijobs und keine sozialversicherungspflichtige Anstellung hast? In diesem Fall hängt es davon ab, ob alle deine Einkünfte zusammengerechnet unter der Verdienstgrenze von 556 Euro bleiben. Sobald diese die Geringfügigkeitsgrenze überschreiten, musst du ebenfalls Abgaben an die Sozialversicherung und unter Umständen Steuern zahlen.
Wichtig zu wissen: Wenn du zwei Minijobs zusätzlich zu einer Haupttätigkeit ausübst, ist nur der erste Minijob steuerfrei. Der zweite Minijob wird nämlich entweder pauschal mit 20 Prozent oder gemäß deiner individuellen Lohnsteuer besteuert. Selbst dann wirst du nicht unbedingt vom Finanzamt zur Kasse gebeten. Warum? Das erfährst du im nächsten Abschnitt.
@MinijobZentrale
Meine Zustimmung kann ich jederzeit unter Datenschutz widerrufen.
Wie wird der Minijob besteuert?
Der Minijob ist steuerfrei? Das stimmt so nicht ganz: Hier gibt es wieder Unterschiede zwischen dem 556-Euro-Minijob und der kurzfristigen Beschäftigung. Beim 556-Euro-Minijob zahlt der Arbeitgeber in der Regel einen Steuerpauschbetrag von zwei Prozent an die Minijob-Zentrale – was sich nicht auf das Einkommen auswirkt. Aber die Arbeitgeber dürfen die Pauschsteuer von dem Verdienst der Minijobber*innen abziehen.
Der Minijob kann auch pauschal mit 20 Prozent oder nach individuellen Lohnsteuermerkmalen versteuert werden. Die individuelle Lohnsteuer kann für dich günstiger sein als die Pauschsteuer von zwei Prozent. Denn in den Lohnsteuerklassen 1 bis 5 fallen in diesem Fall null Euro Steuern an.
Kurzfristige Minijobs dagegen müssen immer pauschal mit 25 Prozent oder nach der Lohnsteuerklasse besteuert werden.
Mehr dazu liest du in diesem Ratgeber: „Minijob und Steuern: Wer muss sie zahlen und wer nicht?”.
War der Inhalt für dich hilfreich?
Teile den Artikel:




