
Gemeinschaftskonto: Das müssen WGs, Paare, Vereine und Co. wissen

Gemeinsame Ausgaben wie Miete, Essen und Reisen untereinander aufzuteilen ist lästig. Aber kommen Paare, Verheiratete, Vereine, Wohngemeinschaften drum herum? Ja. Mit einem Gemeinschaftskonto. Dabei lauert allerdings die eine oder andere Tücke. Wusstest du zum Beispiel, dass du bei einem gemeinsamen Konto auch für die Schulden der anderen Kontoinhaber*innen haftest? Wann lohnt es sich, ein Konto zu teilen, und wann lässt man besser die Finger davon? Wir machen klar, was du über gemeinsame Konten wissen solltest.
Wenn du ein Tagesgeldkonto bei der Hanseatic Bank hast
... kannst du es auch als Gemeinschaftskonto führen. Mehr dazu und weitere Antworten zum Thema Tagesgeld findest du auf dieser Seite.
Themen in diesem Artikel
- Was ist ein Gemeinschaftskonto?
- Wer kann ein Gemeinschaftskonto eröffnen?
- Wer haftet bei einem Gemeinschaftskonto?
- Läuft das Konto auf den Namen aller Kontoinhaber*innen?
- Kann man ein bestehendes Konto in ein Gemeinschaftskonto umwandeln?
- Müssen alle gleich viel Geld einzahlen?
- Was ist der Unterschied zwischen dem Und-Konto und Oder-Konto?
- Was passiert, wenn ein*e Kontoinhaber*in stirbt?
- Kann man das Konto auflösen oder sperren?
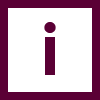
Auf den Punkt
- Ein Gemeinschaftskonto hilft mehreren Personen, gemeinsame Finanzen zu verwalten – zum Beispiel in einer WG oder einem Verein.
- Das gemeinsame Konto läuft auf alle Namen, und alle haften gemeinsam.
- Ein Einzelkonto lässt sich meist nicht in ein Gemeinschaftskonto umwandeln. Eine Alternative ist eine Kontovollmacht – dabei haften aber nur die Kontoinhaber*innen.
- Bei der Auflösung wird das Guthaben in der Regel gleich aufgeteilt, es sei denn, es gibt eine andere schriftliche Vereinbarung.
- Im Todesfall geht der Anteil der verstorbenen Person an die Erb*innen über.
Was ist ein Gemeinschaftskonto?
Ein Gemeinschaftskonto ist ein Konto, das du mit einer oder mehreren anderen Personen teilst. Sprich: Ihr verwaltet das Konto ‒ meistens ein Girokonto ‒ zusammen, und alle haben darauf Zugriff, können damit Überweisungen vornehmen oder sich davon Geld auszahlen lassen. Ein Gemeinschaftskonto ist sinnvoll, wenn ihr regelmäßige gemeinsame Ausgaben habt. Bei einer Wohngemeinschaft kann ein WG-Konto zum Beispiel für die Miete, die Stromrechnung und das Internet praktisch sein.
Für unregelmäßige gemeinsame Ausgaben wie Hochzeitsgeschenke oder Urlaube gibt es praktische Alternativen. Welche das sind, erfährst du im Ratgeber „Alternativen zu Moneypool: Geld sammeln mit Paypal & Co.”.
Extra-Tipp: Möchtet ihr gemeinsam sparen, zum Beispiel für neue Haushaltsgeräte? Dann ein gemeinsames Tagesgeldkonto eine gute Wahl sein. Der Vorteil: Eure Ersparnisse werden verzinst und ihr habt das nötige Geld schneller zusammen. Der Nachteil: Für laufende Zahlungen wie Miete ist es nicht geeignet.
Für den Extra-Euro zwischendurch
Klar, Geld anlegen und Zinsen kassieren ist prima. Aber ans Festgeld kommt man im Notfall nicht heran. Ein Sparbuch bringt kaum Ertrag. Die Lösung: Das TagesGeld der Hanseatic Bank mit attraktiven Zinsen. Und trotzdem ist das Geld täglich verfügbar. Für einen Sonderwunsch – oder falls etwas mal nicht nach Wunsch läuft.

Wer kann ein Gemeinschaftskonto eröffnen?
Viele Banken bieten Konten für zwei Menschen aus einem Haushalt an. Dabei ist oft nur dieselbe Adresse wichtig, nicht der Status ‒ der Bank ist es egal, ob ihr als Ehepaar oder unverheiratet ein gemeinsames Konto eröffnet. Aber auch für Firmen, Vereine und weitere Zusammenschlüsse gibt es Optionen, ein gemeinsames Konto zu eröffnen. Bei einigen Kreditinstituten, Smartphone- und Onlinebanken können bis zu 25 Menschen ein Konto teilen.

Wer haftet bei einem Gemeinschaftskonto?
Jede*r Einzelne. Das heißt: Wenn eine*r deiner Kontopartner*innen Schulden anhäuft und es zu einer Pfändung kommt, wird auch das Gemeinschaftskonto gepfändet – bis die Schulden getilgt sind. Es spielt keine Rolle, wer bei dem Konto wie viel eingezahlt oder ausgegeben hat. Es ist auch egal, ob du für die Schulden verantwortlich bist oder nicht. Auch wenn eine*r der Kontoinhaber*innen einem Cyberbetrug zum Opfer fällt, müssen alle dafür geradestehen.
Je mehr Personen ein Konto gemeinsam verwalten, desto höher ist das Risiko für die Einzelperson. Lass dich deshalb nur darauf ein, wenn ihr euch gegenseitig vertraut. Ist die Vertrauensbasis eher wacklig, aber ein Gemeinschaftskonto notwendig, wählt ihr besser die Und-Variante. Auf die Unterschiede zwischen der Und-und Oder-Variante kommen wir gleich noch zurück.
Läuft das Konto auf die Namen aller Kontoinhaber*innen?
Ja, das ist bei dem klassischen Gemeinschaftskonto der Fall. Deshalb haften auch alle gemeinsam für das Konto. Es gibt aber eine Ausnahme: Du kannst das Konto nur auf deinen Namen laufen lassen und stellst beliebig vielen Menschen eine Vollmacht für das eigene Konto aus. Die Bevollmächtigten sind dann deine Stellvertreter*innen. Sie können alle auf das Konto zugreifen. Allerdings: Die Bevollmächtigten haften nicht ‒ auch wenn eine*r von ihnen den finanziellen Schaden verursacht hat. Eventuelle Kosten bleiben bei dieser Variante also an dir hängen.
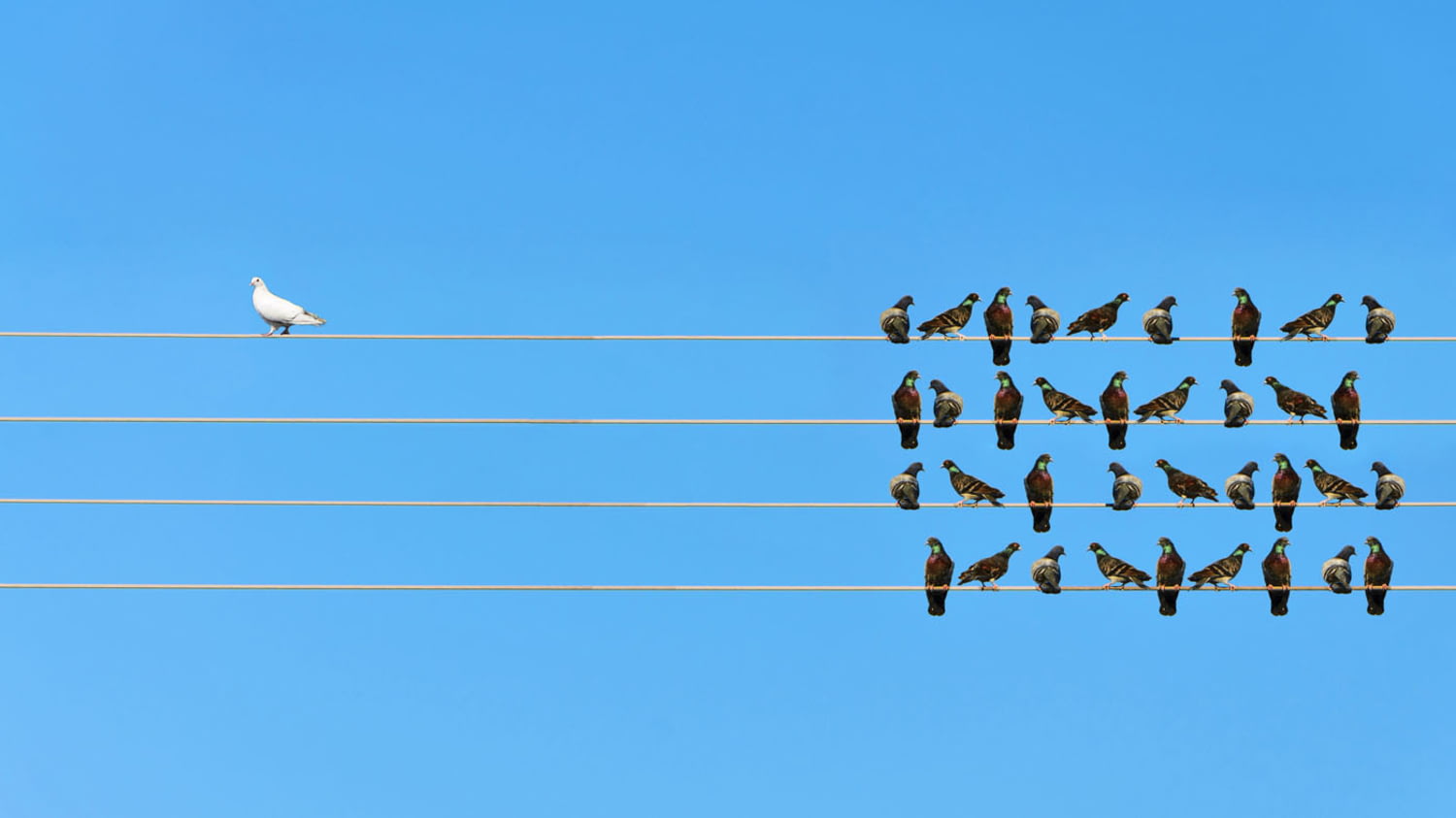
Kann man ein bestehendes Konto in ein Gemeinschaftskonto umwandeln?
Bei den meisten Banken musst du ein neues Konto eröffnen. Behalte dein eigenes Konto für deine persönlichen Rechnungen. Große Ersparnisse haben ebenfalls auf dem Gemeinschaftskonto nichts zu suchen. Warum? Falls du mal eine größere Geldsumme auf das gemeinsame Konto einzahlst, kann das Finanzamt es als Schenkung werten. Schließlich können alle Kontoinhaber*innen auf diese Summe zugreifen. Unter Umständen verlangt das Finanzamt dann Schenkungssteuern von dir.
Müssen alle immer gleich viel Geld einzahlen?
Wer von euch wie viel einzahlt, spielt keine Rolle. Es kann auch nur eine Person Geld auf das Konto überweisen. Bei manchen Konten müsst ihr monatlich eine Mindestsumme einzahlen. Oder es muss ein Mindestguthaben auf dem Konto vorhanden sein.
Wichtig zu wissen: Das Kontoguthaben gehört allen Inhaber*innen. Solltet ihr das Konto auflösen, zum Beispiel wegen einer Trennung oder Firmenschließung, steht jeder Person die Hälfte zu. Beziehungsweise bei mehreren Kontoinhaber*innen zu gleichen Teilen. Und das unabhängig davon, wer wie viel Geld eingezahlt hat. Wenn ihr eine andere Aufteilung wollt (zum Beispiel danach, wer wie viel eingezahlt hat), müsst ihr das in einer gemeinsamen schriftlichen Vereinbarung festhalten.
Worauf solltest du bei einem Gemeinschaftskonto achten?
- Erkundigen dich sich über die Kontokonditionen. Lies Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen: Kann man es einseitig von einem Oder- in ein Und-Konto umwandeln? Gibt es eine Mindestsumme, die immer auf dem Konto sein muss?
- Finde Sie die geeignete Variante. Mögliche Kontoarten: Und-Konto, Oder-Konto, Kontovollmacht, Geschäftskonto.
- Kläre Sie Wichtiges in einer schriftlichen Vereinbarung. Zum Beispiel: Was passiert im Todesfall mit dem Geld? Wer erbt welchen Anteil?
- Behalte ein eigenes Konto für deine persönlichen Ausgaben. Falls andere Kontoinhaber*innen finanzielle Schwierigkeiten haben, kann es sinnvoll sein, dein Guthaben rechtzeitig auf dein Einzelkonto zu überweisen.
- Lagere Sie keine größeren Geldsummen auf dem gemeinsamen Konto. Und zahle auch keine ein. Mögliche Risiken: Schenkungsteuer, Pfändung, Haftung und Erb*innen im Todesfall.
Was ist der Unterschied zwischen dem Und-Konto und Oder-Konto?
Beide Kontenarten sind eine Variante des Gemeinschaftskontos. Das Oder-Konto können alle Inhaber*innen unabhängig voneinander benutzen. Das heißt: Jede*r kann das Geld abheben, überweisen oder damit bezahlen. Für Partner*innen, Wohngemeinschaften und Ähnliches ist diese Variante praktischer. Aber nur, wenn man sich gegenseitig vertrauen kann.
Beim Und-Konto können die Inhaber*innen nur gemeinsam darauf zugreifen. Niemand kann ohne die Unterschrift des*der anderen Geld überweisen, einzahlen oder abheben. Vereine und Organisationen nutzen oft diese Kontoform. So kann niemand das Kontoguthaben für andere Zwecke missbrauchen. Deshalb bietet es sich auch für Erbengemeinschaften an (Näheres dazu im nächsten Kapitel).
Der Verwaltungsaufwand ist bei diesem Konto für die Bank sehr hoch. Deswegen bieten nicht alle Banken Und-Konten an.

Was passiert, wenn ein*e Kontoinhaber*in stirbt?
Bei einem Todesfall treten die Erb*innen im Gemeinschaftskonto an die Stelle der verstorbenen Person. Sie erben ihren Anteil vom Kontoguthaben. Oder von den Schulden, wenn das gemeinsame Konto im Minus ist. Kläre deswegen am besten schriftlich, wer im Todesfall wie viel Geld erhält. Bei einem Und-Konto kann der*die lebende Kontoinhaber*in nur gemeinsam mit den Erb*innen auf das Konto zugreifen. Für Erbengemeinschaften kann das von Vorteil sein: Niemand kann das Geld der verstorbenen Person unberechtigt vom Konto abheben.
Was ist eine Erbengemeinschaft?
Die Erbengemeinschaft ist eine Gruppe von Personen, die gemeinsam erben. Die sogenannten Miterb*innen erhalten je einen Anteil aus dem Nachlass einer verstorbenen Person ‒ während ein*e Alleinerb*in alles erbt.
Kann man das Gemeinschaftskonto sperren oder auflösen?
Braucht ihr das gemeinsame Konto nicht mehr ‒ wegen eines Umzugs oder einer Trennung ‒, könnt ihr es auflösen. Ihr stellt bei der jeweiligen Bank den Kündigungsantrag, dem alle mit einer Unterschrift zustimmen müssen. Möchte eine Person das Konto behalten, kann sie das gemeinsame Konto auf sich selbst umschreiben lassen. Erledigt.
Aber: Besonders nach einer Scheidung oder unschönen Trennung kann das ein Problem sein. Das Konto hält dann vielleicht länger als die Partnerschaft. Oder es wird von einer Seite geplündert. Eine einseitige Sperrung ist nicht möglich. Wirtschaftlichen Schäden kannst du dennoch vorbeugen: Indem du das Oder-Konto in ein Und-Konto umwandelst. Dadurch können die anderen Kontoinhaber*innen nicht ohne deine Unterschrift auf das Geld zugreifen. Erkundige dich am besten vor der Kontoeröffnung bei der Bank, ob dies laut AGB möglich ist.
War der Inhalt für dich hilfreich?
Teile den Artikel:




