
Emissionen ausgleichen: So funktioniert die CO₂-Kompensation

Der Umwelt zuliebe lässt du beispielsweise so oft wie möglich dein Auto stehen, um Energie und Emissionen zu sparen? Das ist gut. Aber dann weißt du auch, dass sich manch schädliche Aktivitäten auch beim besten Willen nicht vermeiden lassen. Die Treibhausgase, die dabei mal direkt, mal indirekt entstehen, kannst du mit einer freiwilligen CO₂-Kompensation ausgleichen – gegen Geld. Wie das funktioniert und worauf du dabei achten solltest, zeigen dir die KlarMacher.
Themen in diesem Artikel
- Was ist der Sinn der CO₂-Kompensation?
- Das Prinzip der freiwilligen Kompensation
- Was kannst du kompensieren?
- Mit diesen Maßnahmen gleichst du deine CO₂-Bilanz aus
- Wie wählst du den richtigen Anbieter?
- Die Sache mit den Zertifikaten und den Qualitätsstandards
- Die Kritik an der CO₂-Kompensation
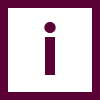
Auf den Punkt
- Mit der freiwilligen CO₂-Kompensation kannst du den von dir erzeugten Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid ausgleichen.
- Die Kompensation erfolgt über den Kauf von Zertifikaten, die du über Projekte bekommst, die zu diesem Zweck gegründet wurden.
- Mehrere Qualitätsstandards erleichtern den Vergleich dieser Initiativen.
Was ist der Sinn der CO₂-Kompensation?
Heftige Hitze und Kälte, Niederschläge und Dürren – solche extremen Wetterereignisse treten durch den Klimawandel immer häufiger auf. Treibende Kraft dahinter: menschengemachte Emissionen. Gemeint ist der Ausstoß von umweltschädlichen Stoffen, Teilchen oder Strahlungen. Einen wesentlichen Anteil daran haben die sogenannten Treibhausgase, die die Erderwärmung fördern. Zu ihnen gehören hauptsächlich:
- Kohlendioxid (CO₂), auch Kohlenstoffdioxid genannt
- Methan (CH₄)
- Lachgas (N₂O)
- Wasserstoffhaltige Fluorkohlenwasserstoffe (HFKW)
- Perfluorierte Kohlenwasserstoffe (FKW)
- Schwefelhexafluorid (SF₆)
- Stickstofftrifluorid (NF₃)
Darunter ist CO₂ der größte schädliche Faktor. Es entsteht vor allem bei der Verbrennung beziehungsweise Nutzung fossiler Energieträger. Das sind in der Regel Kohle, Erdöl und Erdgas. Freigesetzt wird CO₂ überwiegend bei der Erzeugung von Strom und Wärme, im Verkehr, in der industriellen und landwirtschaftlichen Produktion sowie von privaten Haushalten.
Wegen seiner negativen Auswirkungen auf die Umwelt ist es also gut, möglichst wenig Kohlendioxid zu erzeugen. Deshalb sparen es bereits viele Menschen in ihrem privaten Umfeld ein. Das heißt beispielsweise: Sie …
- verringern den Treibstoffverbrach beim Autofahren.
- nutzen öfter den öffentlichen Nahverkehr oder das Fahrrad.
- essen seltener oder gar kein Fleisch.
- stellen zu Hause die Heizung niedriger ein.
- investieren in „grüne” Geldanlagen, die umweltfreundliche Aktionen unterstützen.
So wollen sie ihre persönliche CO₂- beziehungsweise Kohlendioxid-Bilanz verringern. Die entspricht in Deutschland pro Person und Jahr durchschnittlich 11,17 Tonnen (Stand 2021) an Treibhausgasen.
Das bedeutet CO₂-Bilanz
Die persönliche CO₂-Bilanz zeigt, wie viele Emissionen ein Mensch durch sein alltägliches Verhalten innerhalb eines bestimmten Zeitraums erzeugt. Dabei geht es sowohl um eigene Aktivitäten (zum Beispiel Autofahren, Fliegen) als auch um den indirekten Verbrauch. Das kann der Kauf von Erzeugnissen oder Dienstleistungen sein, die ihrerseits zum Ausstoß klimaschädlicher Gase beitragen. Umgangssprachlich wird die CO₂-Bilanz auch als CO₂-Fußabdruck bezeichnet. Je kleiner er ist, desto besser.
Doch nicht immer lässt sich umweltschädliches Verhalten umgehen. Zum Beispiel Flüge aus beruflichen Gründen oder für Besuche weit entfernt lebender Verwandte. Vor allem bei Fernreisen sind große Passagiermaschinen oft das geeignetste Verkehrsmittel, weil andere einfach zu lange bis zum Ziel brauchen. Doch gerade Jets stoßen vergleichsweise viel CO₂ aus.
Wer zum Beispiel von Düsseldorf nach New York und zurück düst, vergrößert seinen CO₂-Fußabdruck um immerhin 3,65 Tonnen. Gemessen an der durchschnittlichen, persönlichen Kohlendioxid-Bilanz ist das eine ganze Menge. Eingerechnet sind dabei keine weiteren, durch Flüge hervorgerufenen Stoffe. Dazu zählen Stickoxide, Aerosole und Wasserdampf. Auch sie haben einen negativen Einfluss auf die Atmosphäre.
Einen Ausgleich soll die sogenannte freiwillige CO₂-Kompensation schaffen: Dieselbe Menge Kohlendioxid, die zum Beispiel bei einem Flug angefallen ist, kann an anderer Stelle eingespart werden. Dafür geben Flugreisende Geld an bestimmte Organisationen oder Unternehmen. Die finanzieren damit Projekte, die Treibhausgase vermindern, etwa in Entwicklungsländern. So ein CO₂-Ausgleich funktioniert nicht nur bei Flügen.

Um es klar zu sagen: Der Emissionsausgleich kann die Entstehung von Kohlendioxid nicht vermeiden. Stattdessen geht es bei der CO₂-Kompensation per Definition darum, erzeugtes zu neutralisieren. Sinnvoller ist es natürlich, durch eigenes Verhalten Treibhausgase komplett zu vermeiden oder zumindest zu verringern.
Ein weiteres wichtiges Merkmal der freiwilligen CO₂-Kompensation ist, dass sie ausschließlich Klimaschutzprojekte unterstützt, die es sonst nicht geben würde. Was heißt das? Die geförderten Aktivitäten dürfen nur zum Zwecke des freiwilligen CO₂-Ausgleichs stattfinden, also nicht zu Projekten für den Umweltschutz gehören, die ohnehin schon laufen.
Das Prinzip der freiwilligen Kompensation
Wer den eigenen CO₂-Fußabdruck kompensieren möchte, muss dafür bezahlen. Und zwar an Organisationen, die mit dem Geld Klimaschutzprojekte aufbauen beziehungsweise unterstützen. Das tun sie in Deutschland sowie rund um den Globus, denn für die Kompensation ist es egal, wo sie stattfindet: Die Erderwärmung kennt keine Grenzen. Das heißt, du kannst hier entstandene Emissionen etwa mit einer Klimaaktion auf der anderen Seite der Welt ausgleichen.
Wie viel dich der Ausgleich kostet, hängt davon ab, welche Menge an CO₂ durch dich angefallen ist. Je mehr, desto teurer wird es, das zu neutralisieren. Also musst du zunächst herausfinden, um wie viel Kohlendioxid es in deinem Fall geht. Am einfachsten ist es, wenn du deine CO₂-Kompensation mit einem Rechner im Internet bestimmen. Den stellen dir viele Anbieter oder auch das Umweltbundesamt kostenlos zur Verfügung.
Für den ermittelten Wert überweist du dem gewählten Dienstleister Geld. Damit kaufst du indirekt sogenannte Emissionsminderungsgutschriften, auch als Emissionszertifikate oder CO₂-Minderungszertifikate bezeichnet. Was es damit auf sich hat, erklären wir weiter unten im Kapitel „Die Sache mit den Zertifikaten und den Qualitätsstandards“. Mit dem Kauf hast du deine Kompensation für dein erzeugtes CO₂ abgeschlossen.
Video: CO₂-Kompensation im Flugverkehr: Bringt das wirklich was fürs Klima?
Meine Zustimmung kann ich jederzeit unter Datenschutz widerrufen.
Was kannst du kompensieren?
Wie bereits beschrieben, ist es möglich, den CO₂-Ausstoß eines Flugs zu kompensieren. Doch das ist bei Weitem nicht die einzige Option für einen Ausgleich. Schließlich werden Treibhausgase auch auf andere Art und Weise erzeugt. Zum Beispiel im Zusammenhang mit …
- Wohnen (z. B. sehr viel Wohnfläche, alte Heizungsanlage)
- Strom (z. B. keine Nutzung erneuerbarer Energien, Stromfresser)
- Mobilität (z. B. Auto mit viel Verbrauch)
- Ernährung (z. B. wenig regionale Lebensmittel, hoher Fleischkonsum)
Deshalb kannst du so eine CO₂-Kompensation nicht nur für einen Flug oder Ihr Auto leisten, sondern für zahlreiche andere Aktivitäten. Sogar in deinem Garten. Denn auch bei der Herstellung von herkömmlichem Dünger entsteht viel Kohlendioxid.
Wie verkleinere ich meinen ökologischen Fußabdruck?
In diesen fünf Ratgebern bekommst du viele praktische Tipps du wie du deine CO₂-Bilanz verbessern kannst:
- Strom sparen: Mit diesen Tipps senkst du die Kosten
- Heizkosten sparen: 9 Tipps für warme Füße für weniger Geld
- Wie lassen sich mit weniger Kraftstoff mehr Kilometer fahren?
- Wasser sparen: Mit diesen 7 Tipps die Haushaltskasse aufbessern
- Energie sparen: So viel bringen neue Haushaltsgeräte
Mit diesen Maßnahmen gleichst du deine CO₂-Bilanz aus
Möchtest du deine Emissionen kompensieren, hast du die Wahl zwischen vielen Initiativen, die du mit dem Kauf von Emissionszertifikaten unterstützen kannst. Alle zielen darauf ab, möglichst viele erneuerbare Energien möglichst effizient einzusetzen sowie CO₂ zu vermeiden oder durch Wälder zu binden. Das soll unter anderem durch solche Projekte gelingen:
- Energieeffiziente Öfen zum Kochen
- Unterstützung beim Kohleausstieg
- Finanzierung von Wind- und Solaranlagen sowie Wasserkraftwerken
- Initiativen zur Umweltbildung für Kinder und Jugendliche
- Aufforstung
- Förderung von Trinkwasserbrunnen
- Deponiegas-Verwertung und Methan-Vermeidung
- Nachhaltige Landbewirtschaftung
Viele Projekte finden in Entwicklungsländern statt. Es gibt aber auch welche, die in Industrieländern aktiv sind. Das betrifft beispielsweise die CO₂-Kompensation in Deutschland durch mehr Bäume. Oder den Schutz von Mooren, die doppelt so viel Kohlendioxid speichern, wie weltweit in den Wäldern steckt. Werden die Feuchtgebiete entwässert, so setzen sie das Gas frei. Übrigens: Die einzig wahre und beste CO₂-Kompensation gibt es nicht. Hauptsache ist, dass du einen Ausgleich erreichst. Wie (und wo), das ist unerheblich beziehungsweise hängt von deinen Vorstellungen ab.

Wie wählst du den richtigen Anbieter?
Manchmal ist die Kompensation von CO₂ ganz einfach. Zum Beispiel dann, wenn du eine Urlaubsreise machen willst. Denn einige Touristikunternehmen, darunter Reiseportale sowie Flug- und Busgesellschaften, bieten dir bei der Buchung Emissionszertifikate an. Und zwar automatisch für die Menge an Kohlendioxid, die anteilig während deines Flugs oder deiner Fahrt hin und zurück anfällt. So hast du die Möglichkeit, direkt mit dem Ticketkauf deine CO₂-Kompensation zu leisten.
Du kannst aber auch später deine Emissionen ausgleichen, indem du Zertifikate bei spezialisierten Organisationen und Unternehmen erwerben.
Doch wie findest du das ideale Projekt für deine CO₂-Kompensation? Die Auswahl ist nämlich groß, aber in der Qualität recht unterschiedlich. Seriöse Anbieter erkennen Sie unter anderem an folgenden Merkmalen:
- Sie ermuntern dich zwar dazu, deinen CO₂-Verbrauch auszugleichen. Aber sie betonen auch, dass es besser ist, so wenig wie möglich Treibhausgas zu erzeugen. Bei diesen Anbietern steht also das Geschäft (und der Gewinn) mit den Zertifikaten nicht an erster Stelle, sondern der Schutz der Umwelt.
- Sie informieren detailliert über die gegründeten oder unterstützten Projekte, zeigen die jeweils erreichten CO₂-Einsparungen auf und wie sie diese berechnen.
- Sie legen ihre Finanzen offen, gewähren Einblicke in ihre Gewinn- und Verlustrechnung und in die Kosten der einzelnen Maßnahmen.
- Sie lassen ihre Finanzen von unabhängigen Stellen überprüfen.
- Sie führen die Qualitätsstandards auf, nach denen sie arbeiten. Mehr dazu im folgenden Kapitel.
Anhand dieser und weiterer Kriterien hat die Stiftung Warentest einen Vergleich unter mehreren Anbietern von CO₂-Kompensation gemacht. Mit „sehr gut” schnitten dabei Atmosfair, Klima-Kollekte und Primaklima ab.

Die Sache mit den Zertifikaten und den Qualitätsstandards
Für Außenstehende ist es nicht leicht, die Wirkung von Projekten zur CO₂-Kompensation zu beurteilen. Um es einfacher zu machen, wurden unterschiedliche Qualitätsstandards eingeführt. Auf der Webseite der Bundesumweltamtes sind einige Beispiele für die wichtigsten Qualitätsstandards in Deutschland gelistet:
Internationale Standards
Zusätzliche Standards (nur in Kombination mit anderen Standards)
Regionaler Standard
Die Vorteile der Qualitätsstandards liegen auf der Hand. Sie sorgen für vergleichbare Maßstäbe und dafür, dass diese nachweislich befolgt werden. Das wird regelmäßig von unabhängigen Stellen geprüft (zum Beispiel vom TÜV Süd), die die einzelnen Projekte in der Regel einmal pro Jahr besuchen. Dabei kontrollieren sie, ob die versprochenen Emissionseinsparungen erreicht werden. Das nennt sich Verifizierung.
Für jede verifiziert eingesparte Tonne CO₂ erhalten die Projekte jeweils ein Zertifikat. Das ist der Beleg für den Erfolg einer Maßnahme. Je nachdem, wie viel Kohlendioxid durch dich ausgestoßen wurde, kannst du eine entsprechende Anzahl dieser Zertifikate kaufen. Die sind in öffentlichen Projekt-Datenbanken gespeichert. Sobald du eins kaufst, wird es daraus gelöscht. Das verhindert eine mehrfache Verwendung.
CO₂-Steuer: Dein Beitrag zum Klimaschutz
Die CO₂-Steuer, auch „CO₂-Preis“ genannt, ist ein Preisaufschlag auf fossile Brennstoffe wie Benzin, Diesel, Heizöl oder Erdgas. Sie wurde in Deutschland im Jahr 2021 eingeführt und soll dazu anregen, weniger fossile Brennstoffe zu nutzen. Das Prinzip hinter dieser Energiesteuer ist simpel: Je mehr CO₂ bei der Nutzung eines Energieträgers freigesetzt wird, desto teurer wird es.
Am 1.1. 2025 wurde der der CO₂-Preis von 45 Euro auf 55 Euro pro Tonne CO₂ angehoben. Das bedeutet: Autofahren und Heizen mit fossilen Brennstoffen ist teurer geworden. Für das Jahr 2026 ist eine weitere Anhebung geplant.
Die Einnahmen durch die CO₂-Steuer fließen in den Klima- und Transformationsfonds – und von dort aus unter anderem in klimafreundliche Projekte.
Die Kritik an der CO₂-Kompensation
Die Idee, für den CO₂-Ausgleich zu zahlen, hat auch Gegner*innen. Viele bezeichnen sie als einen modernen Ablasshandel. Heißt: Mit ihm können sich Menschen von den eigenen Umweltsünden freikaufen und sich so ein reines Gewissen zulegen. Weitere Kritikpunkte an der CO₂-Kompensation:
- Es ist sehr schwierig, den genauen persönlichen CO₂-Ausstoß zu ermitteln. Die Rechner der Anbieter arbeiten nicht nach einheitlichen Kriterien.
- Die langfristigen Einsparungen durch Klimaschutzprojekte sind schwer absehbar. So ist bei der Aufforstung zum Zweck der CO₂-Kompensation nicht sicher, wie lange die Bäume nach ihrer Pflanzung stehen bleiben. Oder ob in Entwicklungsländern bereitgestellte energiesparende Öfen tatsächlich dauerhaft genutzt werden.
- Die private CO₂-Kompensation kann ihren hauptsächlichen Zweck verfehlen: Durch den Ausgleich verleitet sie womöglich dazu, mehr Kohlendioxid zu erzeugen, als erforderlich ist.
War der Inhalt für dich hilfreich?
Teile den Artikel:




