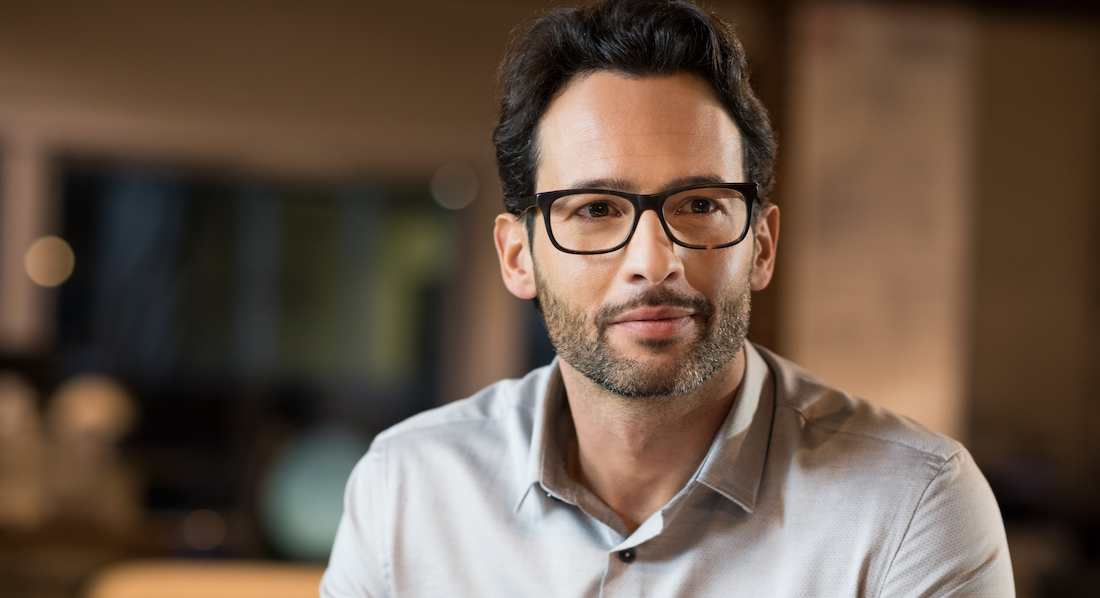Alles Bank oder was? Das sind die Unterschiede zwischen Bank, Sparkasse und Genossenschaftsbank

Hast du dich auch schon mal gefragt, warum manche Kreditinstitute Banken und andere Sparkassen heißen? Ist das Zufall? Nein, denn dahinter steckt System. Um genau zu sein – das Bankensystem in Deutschland. Es besteht im Wesentlichen aus privaten Banken, öffentlichen Banken und Genossenschaftsbanken. Aber was ist was? Und was sind die Unterschiede? Die KlarMacher sagen es dir.
Themen in diesem Artikel
- Die drei Säulen des deutschen Bankensystems
- Private Banken: Auf den Gewinn konzentriert
- Öffentliche Banken: Auf das Gemeinwohl konzentriert
- Genossenschaftsbanken: Auf die Mitglieder konzentriert

Auf den Punkt:
- 3-Säulen-Bankensystem: Das deutsche Bankensystem basiert auf drei Säulen: privaten Banken, öffentlichen Banken (Sparkassen) und Genossenschaftsbanken.
- Was sind Kreditinstitute? Kredit- oder Geldinstitute sind Einrichtungen, die Bankgeschäfte betreiben. Sie verwalten Geldanlagen und vergeben Kredite.
- Wie funktionieren private Banken? Private Banken sind in Privatbesitz und sind auf möglichst viel Gewinn ausgerichtet.
- Ist eine Sparkasse eine Bank? Ja. Sie sind öffentlich-rechtliche Kreditinstitute. Das heißt, sie gehören meistens den Kommunen und sollen dem Gemeinwohl dienen.
- Was sind Genossenschaftsbanken? Genossenschaftsbanken gehören vielen Menschen gemeinsam und sollen deren wirtschaftliche Stärke fördern.
- Wie wird das Bankensystem reguliert? Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) überwacht, dass die Vorgaben des Kreditwesengesetzes eingehalten werden.
Die drei Säulen des deutschen Bankensystems
Kreditinstitute bieten finanzielle Dienstleistungen für Privatkunden und Unternehmen. Sie werden auch als Geld- oder Finanzinstitute bezeichnet.
Kreditinstitute lassen sich in drei Gruppen einteilen, die drei Säulen des deutschen Bankensystems: private Banken, öffentliche Banken (Sparkassen) und Genossenschaftsbanken. Sie alle gelten als Universalbanken, weil sie für ihre Kund*innen viele Funktionen übernehmen und ein breites Leistungsspektrum bieten. Zu ihren Aufgaben gehören beispielsweise, dass sie:
- Kredite/Darlehen an private Kund*innen sowie an Unternehmen vergeben
- Einlagen annehmen bzw. verwalten, wie Sparguthaben, Girokonten und Wertpapiere
- selbst eigene Geschäfte betreiben und z. B. in Immobilien investieren
- Dienstleistungen rund um Geldanlagen und den Zahlungsverkehr anbieten (Kontoführung, Währungsumtausch, Handel mit Edelmetallen u. ä.)
- ihre Kund*innen beraten
- Garantien und Bürgschaften übernehmen
Aber lass dich sich nicht täuschen: Obwohl sie alle Universalbanken sind, gibt es doch einen Unterschied zwischen Banken, Sparkassen und Genossenschaftsbanken.
Meine Zustimmung kann ich jederzeit unter Datenschutz widerrufen.
Private Banken: Auf den Gewinn konzentriert
Wie der Name schon sagt, sind private Banken in Privatbesitz. Das heißt, sie gehören einzelnen Personen oder Familien. Und wenn es keine Privatpersonen sind, sind sogenannte Kapitalgesellschaften die Besitzer. Dahinter stecken mehrere Anteilseigner*innen oder Aktionär*innen. Das Geschäftsgebiet von Privatbanken ist nicht begrenzt, weshalb sie international tätig sein können.
Zu den bekanntesten und größten privaten Banken in Deutschland zählen:
- Commerzbank
- Deutsche Bank
- HypoVereinsbank
- Postbank
Die Privatbanken sind die ältesten unter den deutschen Finanzinstituten. In Deutschland gibt es sie seit 1403. Damals gründeten Silfried Guldenschlaff, Jekil Humbrecht zu Schlammstein und Johann Palmstorffer zum Quydenbaum das erste Geldhaus Deutschlands. Als älteste inhabergeführte Privatbank gilt die Hamburger Berenberg Bank, die es noch heute gibt.
Zwar gab es in der langen Geschichte der Banken auch schon vorher Kreditgeber und Geldwechsler. Doch diese Banken neuen Typs arbeiteten mit dem Geld, das sie bei ihren Kund*innen zuvor eingesammelt hatten. Die Aufgabe: das Geld so anlegen, dass es Gewinn abwirft – für die Kunden, aber auch für die Besitzer der Bank. Die rechtliche Grundlage für ihr Geschäft ist das deutsche Kreditwesengesetz.
Kreditwesengesetz
Das deutsche Kreditwesengesetz regelt und kontrolliert, wie Kreditinstitute arbeiten. Es schreibt zum Beispiel vor, was Banken, Sparkassen und Genossenschaftsbanken beachten müssen, wenn sie Kredite vergeben. Oder auch, wie sie über ihre Geschäfte berichten müssen. Damit gibt das Kreditwesengesetz der Branche einen rechtlichen Rahmen vor. So schützt es die Kund*innen dank der vorgeschriebenen Einlagensicherung weitgehend davor, dass sie ihr Erspartes verlieren. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), die gemeinsam mit der Deutschen Bundesbank die Bankenaufsicht bildet, achtet darauf, dass die Vorgaben eingehalten werden.
Öffentliche Banken: Auf das Gemeinwohl konzentriert
Anders als Privatbanken (wie zum Beispiel die Deutschen Bank) konzentrieren sich Sparkassen auf regionale und gemeinnützige Aufgaben. Sie gehören zu den öffentlichen, genauer gesagt: öffentlich-rechtlichen Banken. Ihr ursprünglicher Auftrag ist, dass auch die „einfache“, eher arme Bevölkerung etwas Geld ansparen kann und fürs Alter vorsorgen.
Öffentlich-rechtlichen Banken heißen so, weil ihre Eigentümer (Träger) heute meist ein Bundesland, eine Gemeinde oder ein Zweckverband sind. Oder der deutsche Staat, der hinter der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) steht – auch ein öffentlich-rechtliches Kreditinstitut. Andere Beispiele sind:
- Sparkassen
- Landesbanken (LB)/Girozentralen
- Bausparkassen
Wie im Fall der Privatbanken ist auch für öffentlich-rechtliche Kreditinstitute die Stadt Hamburg ein wesentlicher Ausgangspunkt. Dort entstand 1778 die „Ersparungsclasse“ der Allgemeinen Versorgungsanstalt für gemeinnützige Zwecke. Diesen nachhaltigen Ansatz verfolgen öffentlich-rechtliche Banken im Wesentlichen noch heute.
Jede von ihnen ist eigenständig sowie überwiegend regional (Kreissparkasse) oder lokal (Stadtsparkasse) aktiv. Das heißt, dass sie ihre Dienste innerhalb der Grenzen von Städten, Gemeinden, Landkreisen oder eines Bundeslandes anbieten. In ihrem Wirkungskreis müssen sie heute folgende Aufgaben übernehmen:
- flächendeckend für alle Bürger*innen offen sein
- kleine und mittelständische Unternehmen mit Krediten versorgen, um die wirtschaftliche Kraft der jeweiligen Region zu stärken
Ein wesentlicher Unterschied zwischen öffentlich-rechtlichen Banken und privaten Banken: Was Sparkassen und Co. erwirtschaften, soll dem Gemeinwohl in der jeweiligen Region zugutekommen und nicht ihren Besitzern. So steht es in den Sparkassengesetzen der jeweiligen Bundesländer, die für Sparkassen zusätzlich zum Kreditwesengesetz gelten.

Genossenschaftsbanken: Auf die Mitglieder konzentriert
„Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele.“ An diesem solidarischen Leitsatz orientieren sich die Genossenschaftsbanken und ihre Partner. Zu diesem Kreis zählen beispielsweise:
- Volks- und Raiffeisenbanken
- Sparda-Banken
- PSD Banken
Ihr oben genanntes Motto führte im 19. Jahrhundert zur Gründung von sogenannten Kredit- und Darlehenskassenvereinen. Die Idee dazu hatten nahezu gleichzeitig (aber unabhängig voneinander) die Sozialreformer Friedrich Wilhelm Raiffeisen und Hermann Schulze-Delitzsch. Ihr Ziel: Handwerker*innen, Bäuer*innen oder Händler*innen unterstützen. Denn die waren damals von privaten Geldgeber*innen abhängig und dadurch oft in ihrer Existenz bedroht.
Ähnlich wie Sparkassen sind Genossenschaftsbanken eigenständig und vor allem lokal und regional organisiert. Ein großer Unterschied zu privaten und öffentlichen Banken ist allerdings: Die Kund*innen von Genossenschaftsbanken müssen in der Regel Genossenschaftsanteile der Bank erwerben. Damit sind sie praktisch Besitzer*innen ihres Kreditinstituts. Das bedeutet, Kund*innen einer Genossenschaftsbank haben verschiedene Vorteile. Sie:
- sind Mitglieder der Bank
- haben Mitbestimmungsrechte
- sind an den Gewinnen ihrer Genossenschaftsbank beteiligt
Die Anteilsscheine werden verzinst, dürfen aber nicht (wie die Aktien von privaten Banken) verkauft werden. Wer seine Geschäftsanteile ausgezahlt haben möchte, muss dafür seine Mitgliedschaft kündigen. So regelt es das Genossenschaftsgesetz, das neben dem Kreditwesengesetz die Grundlage für Genossenschaftsbanken ist. Es schreibt beispielsweise auch vor, dass eine Genossenschaftsbank dem Gemeinwohl dienen und mindestens drei Mitglieder haben muss.
War der Inhalt für dich hilfreich?
Teile den Artikel: