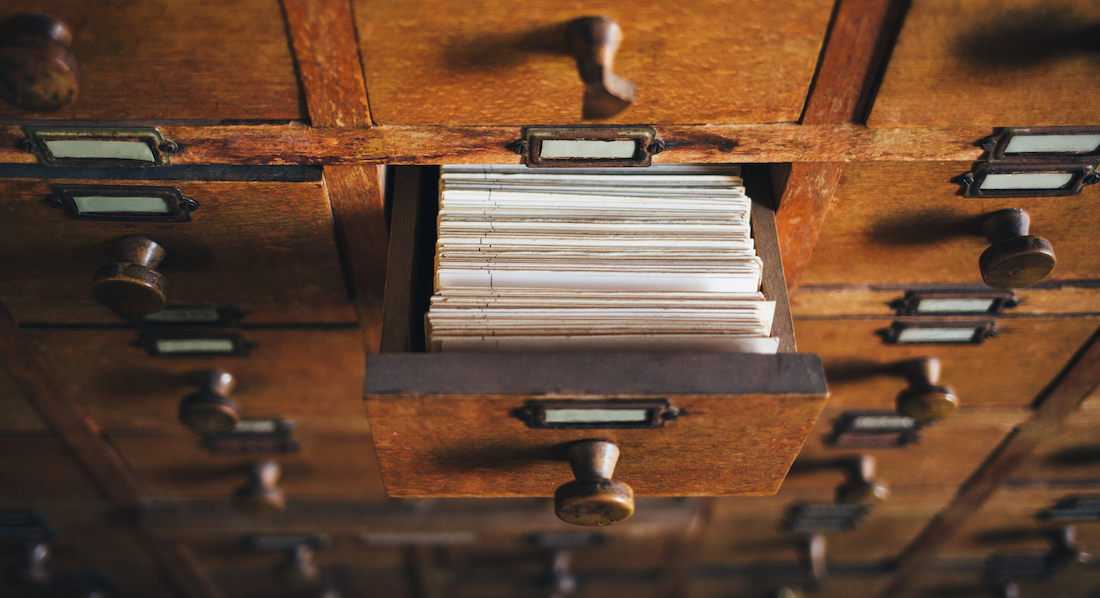Gewusst wie: Antrag auf Privatinsolvenz stellen

Das Konto ist schon lange tief im Minus, die unbezahlten Rechnungen stapeln sich immer höher. Und wenn kein Wunder passiert, dann bleibt das auf lange Sicht so. Wer einen Weg aus dieser Schuldenfalle sucht, kann selbst eine Privatinsolvenz anmelden. Doch wie sieht der erste Schritt dahin aus? Was sind die Voraussetzungen und welche Unterlagen sind erforderlich? Und kann man eine Privatinsolvenz online beantragen? Die KlarMacher geben eine Orientierungshilfe.
Themen in diesem Artikel
- Wann kann ich eine Privatinsolvenz beantragen?
- Wie beantrage ich Privatinsolvenz?
- Ist das Anmelden einer Privatinsolvenz ohne Rechtsvertretung sinnvoll?
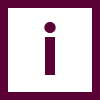
Auf den Punkt
- Bevor du eine Privatinsolvenz anmelden kannst, musst du zuerst versuchen, dich außergerichtlich mit deinen Gläubiger*innen zu einigen.
- Wenn ihr euch nicht einigen könnt, musst du dir das schriftlich bestätigen lassen.
- Den Antrag auf Privatinsolvenz musst du schriftlich beim Amtsgericht einreichen.
- Online kannst du keine Privatinsolvenz beantragen, aber du kannst die Formulare herunterladen.
- Da der Antrag viele Nachweise verlangt, such dir am besten professionelle Unterstützung.
Wann kann ich eine Privatinsolvenz beantragen?
Bevor du überhaupt einen Antrag auf Privatinsolvenz (auch Verbraucherinsolvenz genannt) stellen kannst, musst du erst versuchen, dich mit deinen Geldgeber*innen außergerichtlich auf die Rückzahlung der Schulden zu einigen.
Für einen solchen außergerichtlichen Einigungsversuch mit den Gläubiger*innen stellst du einen Schuldenbereinigungsplan auf, in dem du deine Einkommens- und Vermögenssituation schilderst und mit Zahlen belegst. Außerdem beschreibst du in dem Konzept, wie und in welchem Umfang du deine Rückstände begleichen willst. Das ist zum Beispiel möglich mit:
- Einmalzahlungen
- Ratenzahlungen
- Stundungen
- Zahlungsaufschub
- teilweisem Schuldenerlass
Wenn die Gläubiger*innen mit diesem sogenannten Zahlungsangebot einverstanden sind, dann kommt es gar nicht zur Insolvenz. Lehnen die Gläubiger*innen den Vorschlag jedoch ab, ist der außergerichtliche Einigungsversuch gescheitert. Diesen Ausgang musst du dir schriftlich bestätigen lassen. Diese Bestätigung benötigst du nämlich später, um den Antrag auf Privatinsolvenz zu stellen.
Privatinsolvenzen im Jahr 2024: Zahlen und Hintergründe
Insgesamt gab es im Jahr 2024 in Deutschland 99.991 Privatinsolvenzen. Davon meldeten 15.574 Menschen ab 61 Jahren Privatinsolvenz an – ein Anstieg von 10,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und damit der stärkste Zuwachs unter allen Altersgruppen.
Sechs Hauptgründe führen besonders häufig in die Privatinsolvenz: Arbeitslosigkeit oder geringes Einkommen, gescheiterte Selbstständigkeit, übermäßiger Konsum, familiäre Veränderungen wie Trennung oder Scheidung – sowie Krankheit.
Quelle: Pressemeldung
Wichtig: Die Bescheinigung über das Scheitern der Einigung muss anwaltlich, notariell oder von einer anerkannten Schuldnerberatung ausgestellt sein. Und es darf es kein formloses Schreiben sein, sondern muss den Anforderungen nach § 305 Eröffnungsantrag des Schuldners gemäß der Insolvenzverordnung (InsO) entsprechen. Um hier Fehler zu vermeiden, solltest du dir am besten von einer Rechtsberatung helfen lassen.
Die kannst du auch gleich fragen, wie es nach dem Scheitern des außergerichtlichen Einigungsversuchs weitergehen soll. Zum Beispiel kann die Rechtsberatung klären, ob sich die Insolvenz vielleicht noch mit einer gerichtlichen Schuldenbereinigung abwenden lässt. Dabei prüfen und entscheiden die Richter*innen, ob und wie du deine Schulden bezahlen kannst.
Meine Zustimmung kann ich jederzeit unter Datenschutz widerrufen.
Übrigens: Wenn du mehrere Kredite aufgenommen hast, lohnt es sich als Alternative zur Privatinsolvenz eventuell, einen Umschuldungskredit aufzunehmen. Dann musst du nur noch einen Kredit zurückzahlen – das ist übersichtlicher und ist auch besser für deinen Schufa-Score. Allerdings hilft dir das nur, wenn du einen Kredit mit guten Konditionen bekommst, also einen mit günstigen Zinsen.
Insolvenzantrag besser selbst stellen
Einen Antrag auf deine Privatinsolvenz können – ohne deine Zustimmung – auch deine Gläubiger*innen stellen. Dafür müssen sie deine Zahlungsunfähigkeit allerdings belegen, beispielsweise mit deinen offenen Rechnungen oder an dich verschickten Mahnungen.
Auf einen solchen Fremdantrag solltest du mit einem eigenen Antrag reagieren, denn nur damit hast du die Chance auf die sogenannte Restschuldbefreiung. Das ist der Erlass deiner Schulden am Ende des Insolvenzverfahrens. Andernfalls musst du bei einem Insolvenzantrag durch Gläubiger*innen alle offenen Rechnungen vollständig bezahlen. Es sei denn, die Gläubiger*innen ziehen ihren Antrag zurück.
Wie beantrage ich Privatinsolvenz?
Platzt jeder Einigungsversuch mit den Gläubiger*innen, führt der nächste Schritt zum Insolvenz- beziehungsweise Amtsgericht für deinen Wohnort. Dort stellst du deinen Antrag auf Eröffnung des Privatinsolvenzverfahrens und bekommst eine Reihe von Formularen, die du ausfüllen musst.
Mit dem ausgefüllten Antrag erklärst du offiziell deine Zahlungsunfähigkeit. Anders ausgedrückt: Du bestätigst, dass du deine Rechnungen nicht mehr begleichen kannst. Folgende Dokumente und Anlagen gehören zum Antrag auf Privatinsolvenz:
- Antragsformular für die Eröffnung des Insolvenzverfahrens
- Personalbogen: Angaben zu deiner Adresse usw.
- Bescheinigung über das Scheitern des außergerichtlichen Einigungsversuchs
- Gründe für das Scheitern des außergerichtlichen Schuldenbereinigungsplans
- Abtretungserklärung nach § 287 Abs. 2 InsO: Das ist der Antrag auf die Restschuldbefreiung. Wenn du den nicht stellst, werden dir am Ende des Verfahrens die Restschulden nicht erlassen.
- Vermögensübersicht: mit Angaben zu deinem Vermögen, deinen Einkünften und Ausgaben
- Vermögensverzeichnis: Darin steht im Detail, welche Art von Vermögen du hast, etwa Guthaben auf Konten, Wertpapiere und Wertgegenstände.
- Gläubiger- und Forderungsverzeichnis: Daraus geht hervor, wem und wie viel Geld du schuldest.
- Schuldenbereinigungsplan für das gerichtliche Verfahren: Darin machst du – ggf. neue – Vorschläge für eine einvernehmliche Einigung mit deinen Gläubiger*innen.
Privatinsolvenz beantragen – geht das auch online?
Es ist nicht möglich, eine Privatinsolvenz online anzumelden. Die Beantragung muss in schriftlicher Form beim Insolvenz- oder Amtsgericht erfolgen. Du kannst die Formulare für die Insolvenzeröffnung allerdings vorher online beim Justizportal des Bundes und der Länder herunterladen, ausdrucken und ausfüllen.
Außerdem können sich Betroffene kostenlos online über den Stand ihres Verfahrens erkundigen. Das geht über die Internetseite „Insolvenzbekanntmachungen“. Dort veröffentlichen alle deutschen Insolvenzgerichte zentral die entsprechenden Informationen. Wer sie sehen möchte, muss zuvor in einer Suchmaske verschiedene Angaben zu seinem Fall machen (u. a. Aktenzeichen, Registernummer des Verfahrens).
Ist das Anmelden einer Privatinsolvenz ohne Rechtsvertretung sinnvoll?
Den Antrag auf Privatinsolvenz kannst du selbst stellen. Das macht aber viel Arbeit und muss sehr gewissenhaft erfolgen – zumal von dem Verfahren viel abhängt. Deshalb solltest du dir von einer Fachperson helfen lassen:
- Rechtsanwält*innen und kostenpflichtige Schuldnerberatungsstelle: Für spezialisierte Jurist*innen gehören Anträge auf Privatinsolvenz zum täglichen Geschäft. Sie wissen genau, wie die Unterlagen ausgefüllt werden müssen und welche Angaben dabei zu machen sind. Dafür werden allerdings sowohl bei den Rechtsanwält*innen als auch bei der Schuldberatung Kosten fällig. Wie hoch die sind, regelt für beide das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG). Wichtig: Eine Rechtsschutzversicherung greift dir bei einer Privatinsolvenz nicht finanziell unter die Arme.
- Kostenlose Schuldnerberatungsstelle: Das sind meist staatliche oder gemeinnützige Einrichtungen (z. B. Caritas, Diakonisches Werk). Die Standorte findest du im Schuldnerberatungsatlas des Statistischen Bundesamts. Nachteil: Kurzfristige Termine sind dort oft schwer zu bekommen. Das kann zum Problem werden, wenn während der Wartezeit für deine Schulden Mahngebühren und/oder hohe Zinsen auflaufen.
Wenn dein Einkommen nicht für eine gebührenpflichtige Hilfe reicht, dann kannst du beim Amtsgericht einen Beratungsschein beantragen. Er gilt ausschließlich für eine außergerichtliche Rechtsberatung beziehungsweise Rechtshilfe. Dafür musst du deine Vermögenswerte und dein Einkommen offenlegen. Wird der Antrag genehmigt, brauchst du für die juristische Begleitung bei deinem Privatinsolvenzverfahren höchstens 15 Euro zu bezahlen.
Übrigens: Wie viel du von deinen Einkünften während des Privatinsolvenzverfahrens behalten darfst, erfährst du im Ratgeber „Privatinsolvenz: Wie hoch ist der Selbstbehalt?”.
War der Inhalt für dich hilfreich?
Teile den Artikel: