
Crowdinvesting: Privat in Startups investieren

Wohin mit dem Ersparten, wenn die Zinsen auf dem Sparbuch zu mickrig sind? Vielleicht ist Crowdinvesting ja genau das Richtige für dich. Zusammen mit vielen anderen unterstützt du damit junge, innovative Unternehmen. Schon mit kleinen Beträgen locken – wenn es gut läuft – hohe Renditen. Doch aufgepasst: Wo Chancen sind, lauern auch Risiken. Aber wer Crowdinvesting versteht, kann gezielt investieren – und Teil spannender Projekte werden. Wie solche Schwarmfinanzierungen funktionieren und worauf du achten musst, erfährst du hier!
Themen in diesem Artikel
- Was ist Crowdinvesting?
- Wie unterscheiden sich Crowdinvesting und Crowdfunding?
- Investieren in Startups: Wie kommen Unternehmen und Investitionswillige zusammen?
- Welche Beteiligungsformen gibt es?
- Warum sind Crowdinvestments besonders interessant für Startups?
- Welche Risiken birgt Crowdinvesting?
- Welche Chancen bietet Crowdinvesting?
- Welche Laufzeiten gibt es bei Crowdinvestments?
- Und was ist mit Steuern?
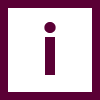
Auf den Punkt
- Beim Crowdinvesting investieren viele Anleger*innen meist kleinere Beträge Summen in junge, innovative Unternehmen.
- Die Parteien finden sich online über Crowdinvesting-Plattformen.
- Crowdinvestments können lukrativ sein. Sie sind aber auch riskant und können zu einem Totalverlust führen.
- Es gibt verschiedene Formen der Beteiligung mit unterschiedlichen Gewinnmöglichkeiten, Verlustrisiken oder Mitspracherechten.
- Crowdinvestments erfordern eine intensive Beschäftigung mit dem Projekt.
Was ist Crowdinvesting?
Der Begriff Crowdinvesting setzt sich zusammen aus den englischen Wörtern „crowd“ (Menge) und „investing“ (investieren). Auf Deutsch ist auch die Rede von Schwarmfinanzierung.
Egal in welcher Sprache, der Name ist Programm: Eine große Anzahl von Kleinanleger*innen, sogenannte Mikroinvestor*innen, steckt kleinere Geldbeträge in ein Unternehmen. Unter bestimmten Bedingungen aber auch höhere Summen möglich. Häufig sind das Startups – junge Unternehmen, die sich noch in der Gründungsphase oder am Anfang ihres Wachstums befinden.

Wie unterscheiden sich Crowdinvesting und Crowdfunding?
Der wesentliche Unterschied liegt in der Gegenleistung: Beim Crowdinvesting investierst du Kapital in ein Unternehmen, um an dessen Erfolg zu verdienen. Kurz: Du willst mit deinem eingesetzten Geld Gewinn machen.
Beim Crowdfunding unterstützt du dagegen überwiegend soziale oder kulturelle Projekte. Die Beteiligung ist eher als Spende zu verstehen. Eine finanzielle Gegenleistung gibt es nämlich meist nicht. Stattdessen erhalten die Geldgeber*innen persönliche Danksagungen und andere ideelle Anerkennungen. Ausnahme: Du förderst ein junges Unternehmen, das beispielsweise ein neues Gerät bauen will und dafür eine Starthilfe braucht. Im Erfolgsfall haben Investor*innen dann oft ein Vorkaufsrecht am Produkt und bekommen es günstiger als andere.
Achtung Verwechslungsgefahr!
Der Begriff Crowdinvesting ist nur im deutschsprachigen Raum gebräuchlich. Die internationale Bezeichnung ist „equity-based crowdfunding“. Das englische Wort „equity“ meint Eigenkapital, also bedeutet „equity-based“ wörtlich „auf Eigenkapital basierend“. Das heißt: Mit deinem Geld bist du am Eigenkapital des Unternehmens beteiligt.
Investieren in Startups: Wie kommen Unternehmen und Investitionswillige zusammen?
Dafür gibt es mehrere Crowdinvesting-Plattformen. Sie unterscheiden sich zum Beispiel bei der Mindestanlagesumme oder sie sind jeweils auf bestimmte Themen oder Branchen spezialisiert. Bekannte Plattformen für Startups sind Onecrowd (früher Seedmatch), Companisto oder auch Green Rockets. Auf solchen Plattformen stellen die Gründer*innen ihre Projekte vor. Dafür setzen sie nicht nur auf nackte Zahlen und handfeste Informationen, sondern oftmals auch auf Bilder und Videos. Vorab wird festgelegt, ...
- wie viel Geld von den Crowdinvestor*innen eingesammelt werden soll,
- bis wann die gewünschte Summe erreicht werden soll,
- welche Gegenleistung die Geldgeber*innen bekommen und
- wie lang die Beteiligungsdauer ist.
Entscheiden sich genügend Personen für ein Investment, erhält das Unternehmen den eingesammelten Betrag. Wird das Finanzierungsziel nicht erreicht, bekommen die Unterstützer*innen ihr Geld zurück.
Rechtlicher Rahmen für Crowdinvesting
In Deutschland ist Crowdinvesting seit 2015 rechtlich reguliert – in erster Linie durch Kleinanlegerschutzgesetz und Vermögensanlagegesetz. Seit 2021 ergänzt die europäische Schwarmfinanzierungs-Verordnung den Rechtsrahmen.
Crowdinvesting-Plattformen unterliegen der BaFin-Aufsicht und müssen zum Schutz der Anleger*innen bestimmte Erlaubnispflichten sowie Transparenz- und Informationspflichten einhalten. Darüber hinaus gelten für private Investor*innen bestimmte Höchstgrenzen für die Beteiligung (Stand: 2025):
- Investitionen bis 1.000 Euro sind unkompliziert möglich.
- Für Beträge bis 10.000 Euro muss man bestätigen, über mindestens 100.000 Euro Vermögen zu verfügen.
- Insgesamt liegt die gesetzliche Höchstgrenze aktuell bei 25.000 Euro.
Die Plattformen vermitteln übrigens nicht bloß zwischen Startups und der „Crowd”, sie prüfen auch die Unterlagen des Unternehmens. Unter die Lupe nehmen Sie:
- das Geschäftsmodell
- den Geschäftsplan
- die aktuelle wirtschaftliche Situation
Das bietet dir zumindest ein gewisses Maß an Sicherheit für das Investitionsvorhaben. Und: Du kannst über die Plattform direkt mit den Unternehmer*innen kommunizieren. Also zum Beispiel nachhaken, wenn du etwas nicht verstehst, Verbesserungsvorschläge machen oder anderweitige Unterstützung anbieten.

Welche Beteiligungsformen gibt es?
Beim Crowdinvesting kannst du auf unterschiedliche Art am Erfolg eines Startups teilhaben. Wie genau, steht im Beteiligungsvertrag. Den solltest du vor deiner Unterschrift gut lesen.
Üblich sind vor allem drei Finanzierungsmodelle:
- partiarisches Darlehen
- atypische stille Beteiligung
- Genussrechte
Partiarisches Darlehen
Ein partiarisches Darlehen ist die häufigste Finanzierungsmethode im Crowdinvesting. Dabei erhältst du eine erfolgsorientierte Verzinsung. Die gibt es allerdings nur, wenn das Unternehmen auch Gewinn macht. Deine Ansprüche auf die Zinsen und auch auf die Rückzahlung deines Gelds werden bei einer Insolvenz des Unternehmens allerdings nur nachrangig behandelt. Das bedeutet: Bei einer Pleite des Projekts werden andere Gläubiger*innen – beispielsweise Banken, die dem Unternehmen einen Kredit gewährt haben – vorgezogen. Du bekommst unter Umständen gar nichts.
Crowdinvesting: Besser als normales Sparen?
Meine Zustimmung kann ich jederzeit unter Datenschutz widerrufen.
Atypische stille Beteiligung
Bei der atypischen stillen Beteiligung bist du als Gesellschafter*in direkt am Unternehmen beteiligt, trittst aber als solche*r nach außen nicht in Erscheinung. Entsprechend deiner Anteile wirst du am Gewinn beteiligt und profitierst zusätzlich vom Wertzuwachs der Firma.
Je nach Vertrag lässt sich deine Beteiligung an möglichen Verlusten des Unternehmens ausschließen. Oder du kannst gesellschaftsrechtliche Mitbestimmungsrechte erhalten. Dann darfst du bei bestimmten geschäftlichen Entscheidungen ein Wörtchen mitreden. Bei einem Zustimmungsvorbehalt musst du zum Beispiel gefragt werden, wenn das Unternehmen neue oder andere Produkte herstellen will.
Genussrechte
Bei der Finanzierung über Genussrechte bekommst du eine Gewinnbeteiligung, hast aber keinerlei Mitsprache- und Stimmrechte.

Warum sind Crowdinvestments besonders interessant für Startups?
Junge Unternehmen brauchen oft Startkapital für ihre Geschäftsidee oder ihr neues Produkt. Und Banken sind in der frühen Phase einer Unternehmensgründung eher zurückhaltend mit Krediten. Schließlich verwalten sie das Geld ihrer Kunden und müssen Rechenschaft über Rendite und Absicherung ihrer Geldgeschäfte ablegen. Also verlangen sie für Darlehen Sicherheiten. Die haben junge Unternehmen aber meist nicht.
Bei der Finanzierung über Crowdinvesting sind solche Sicherheiten nicht nötig. Die Investor*innen vertrauen einzig auf die erfolgversprechende Geschäftsidee und deren professionelle Umsetzung durch die Gründer*innen. Deswegen sind Schwarminvestments eine attraktive Alternative oder zumindest Ergänzung zum Bankkredit.
Welche Risiken birgt Crowdinvesting?
Crowdinvesting ist eine eher riskante Geldanlage. Denn gerade Startups haben ein hohes Ausfallrisiko. Nur wenige setzen sich am Markt durch und haben tatsächlich wirtschaftlichen Erfolg. Und dann meist auch erst nach Jahren. Wenn du dich auf eine solche Investition einlässt, musst du also auch mit einem Totalverlust rechnen – und den vor allem finanziell verkraften können. Deswegen solltest du nur einen kleinen Teil deines Vermögens in diese Form der Geldanlage stecken.
Darüber hinaus raten Expert*innen, das Investitionskapital auf verschiedene Startups zu verteilen – am besten in Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen. Fällt eines aus, können die anderen den Verlust auffangen und unter dem Strich erwirtschaftest du immer noch eine gute Rendite.
Entspann dich! Die Zinsen kommen von allein.
Mit einem SparBrief der Hanseatic Bank blickst du entspannt nach vorn. Denn dein Geld ist sicher angelegt. Und bringt kräftig Zinsen. Da wartet man doch gern.

Welche Chancen bietet Crowdinvesting?
Mit Crowdinvesting kann im Grunde jede*r mit einem überschaubaren Betrag in junge, innovative Unternehmen investieren und vielleicht von Beginn an bei einer Erfolgsgeschichte dabei sein. Und du entscheidest selbst, welches Unternehmen, welche Idee du persönlich fördern und unterstützen möchtest. Das hat unbestreitbar seinen Reiz. Trotzdem ist diese Anlageform nicht für jede*n geeignet.
Es ist nämlich wichtig, sich vor der Anlage sorgfältig damit zu beschäftigen. Dabei geht es um Antworten auf folgende Fragen.
- Verstehst du den Businessplan?
- Bist du überzeugt von den Gründer*innen?
- Verfügen die Verantwortlichen über die nötigen Erfahrungen und Qualifikationen?
- Bringt die Geschäftsidee wirklich einen Nutzen?
- Sind die Erwartungen zu Umsatz und Gewinn realistisch?
Das erfordert nicht nur Zeit, sondern auch ein gewisses Verständnis für das Geschäftsmodell eines Startups. Es ist daher von Vorteil, wenn du bereits mit der entsprechenden Branche vertraut bist. Wer sich der Herausforderung stellt, für den kann Crowdinvesting eine durchaus lohnende Geldanlage sein.

Welche Möglichkeiten drin sind, wollen wir an einem kleinen Beispiel verdeutlichen:
Stell dir vor, du investierst in Form einer atypischen stillen Beteiligung 500 Euro in ein Startup. Damit erhältst du einen Anteil von 0,1 Prozent am Unternehmen und bekommst dementsprechend mögliche Gewinne ausbezahlt.
Angenommen die Firma entwickelt sich gut und hat nach sechs Jahren einen Unternehmenswert von 1,5 Millionen Euro. Davon gehören dir 0,1 Prozent, also 1.500 Euro, plus deine ursprünglichen 500 Euro. Insgesamt ist dein Kapital also auf 2.000 Euro angestiegen, was einer Rendite von 300 Prozent entspricht. Wird aus der Unternehmung jedoch nichts, gewinnst du nichts und kannst im Zweifelsfall auch deine Investition von 500 Euro verlieren.
Welche Laufzeiten gibt es bei Crowdinvestments?
Crowdinvestments sind eine langfristige Anlageform; die Vertragslaufzeiten bei Startups liegen im Durchschnitt bei fünf bis acht Jahren. Ein vorzeitiger Ausstieg ist in der Regel nicht möglich. Prüfe die Vertragsunterlagen dahingehend vor der Investition.
Und was ist mit Steuern?
Das ist abhängig von der Beteiligungsform. Bei nachrangigen Darlehen gelten die Erträge als Einkünfte aus Kapitalvermögen. Damit wird für sie die Abgeltungssteuer von 25 Prozent fällig, zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer.
Anders bei atypischen stillen Beteiligungen: Die Einkünfte gelten als gewerbliche Einnahmen. Diese musst du mit deinem persönlichen Steuersatz versteuern. Bei Genussrechten kommen hingegen verschiedene steuerliche Regelungen zum Tragen – hier kommt es auf die Details im Vertrag an.
War der Inhalt für dich hilfreich?
Teile den Artikel:




