
Was ist die KfW? Alles über die Förderbank

Vielleicht hast du darüber nachgedacht, einen Bildungskredit für ein Studium zu beantragen? Oder du kennst jemanden, der oder die Fördermittel zur energieeffizienten Sanierung einer Immobilie erhält, zum Beispiel um die Fassade zu dämmen oder die Heizung zu erneuern? In diesen Bereichen unterstützt die KfW. Die staatliche Förderbank gibt es tatsächlich schon länger als die Bundesrepublik, und sie ist dazu da, die Verbesserung wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Bedingungen finanziell zu unterstützen. Und das nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit. Was dahintersteckt und wie das funktioniert, erfährst du hier.
Themen in diesem Artikel
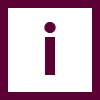
Auf den Punkt
- Die KfW ist eine staatliche Förderbank, das heißt: Im Auftrag des Bundes vergibt sie Geld für wirtschaftliche, soziale und ökologische Projekte.
- Sie fördert unter anderem mittelständische Unternehmen, energieeffiziente Sanierungen, Bildungsprojekte und Investitionen, auch in Entwicklungsländern.
- Auch Privatpersonen können Zuschüsse und Kredite erhalten – zum Beispiel für den Hauskauf, die energetische Sanierung oder eine Ausbildung.
- Kommunen können Geld bekommen zum Beispiel für den Bau barrierefreier Gebäude, die Umstellung auf klimafreundliche Heizsysteme oder die Digitalisierung.
- Gegründet wurde die KfW 1948, um mit Geldern aus dem Marshallplan den Wiederaufbau Deutschlands zu ermöglichen.
- Den Großteil des Fördergeldes leiht sich die KfW bei internationalen Geldgebern – abgesichert durch die Bundesrepublik Deutschland.
Was ist die KfW?
Die Abkürzung KfW steht für Kreditanstalt für Wiederaufbau. Sie ist eine öffentlich-rechtliche Förderbank (siehe Kasten weiter unten), die Geld vergibt, um wichtige Projekte zu unterstützen. Die Projekte dürfen nur aus bestimmten, festgelegten Bereichen kommen, die der Gesetzgeber vorgibt. Zum Beispiel geht es darum, den Mittelstand zu fördern oder Wohnungsbau- und Infrastrukturvorhaben voranzutreiben.
Die KfW ist die drittgrößte Bank Deutschlands mit Hauptsitz in Frankfurt am Main sowie Niederlassungen in Berlin, Bonn und Köln, aber sie hat keine Filialen im eigentlichen Sinne. Kundeneinlagen gibt es auch nicht. Sie ist keine Aktiengesellschaft, sondern eine Anstalt des öffentlichen Rechts – genauso wie zum Beispiel Schulen oder Sparkassen.
Ziel der KfW und ihrer Tochterunternehmen wie KfW IPEX-Bank, DEG und KfW Capital ist es, die nachhaltige Entwicklung voranzutreiben. Und das nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Im Jahr 2024 konnte sie dafür ein Fördervolumen von 112,8 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Schwerpunkt der KfW-Förderung sind:
- Kleine und mittlere Unternehmen und Existenzgründer*innen
- Energieeffiziente Sanierung von Wohngebäuden
- Umweltschutzmaßnahmen
- Bildungsförderung
- Finanzierungsprogramme für Kommunen und regionale Förderbanken
- Export- und Projektfinanzierung
- Projekte in Entwicklungs- und Schwellenländern
All dies ist im KfW-Gesetz von 1948 festgelegt, das seitdem mehrmals an die aktuellen Bedingungen angepasst wurde.

Wie finanziert sich die KfW?
Das Geld, das die KfW vergibt, leiht sie sich zum großen Teil selbst. Und zwar auf den internationalen Kapitalmärkten, also von privaten oder staatlichen Geldgebern. Dabei profitiert die KfW von ihrer hohen Bonität. Denn die Bundesrepublik Deutschland steht im Notfall für ihre Schulden gerade. Deshalb bekommt die KfW Bestnoten von den Ratingagenturen und besonders günstige Kredite. Für bestimmte Aufgaben, zum Beispiel Entwicklungsprojekte, erhält die KfW außerdem Mittel aus dem Bundeshaushalt.
Was ist eine Förderbank?
Eine Förderbank ist eine Spezialbank, die öffentliche Mittel in Form von günstigen Krediten und Zuwendungen vergibt – in der Regel gekoppelt an bestimmte Ziele. Förderbanken arbeiten im öffentlichen Interesse, sie sind nicht in erster Linie auf Gewinn aus.
Auf Bundesebene gibt es neben der KfW noch die Landwirtschaftliche Rentenbank. Außerdem gibt es in Deutschland auch Förderbanken für die einzelnen Länder, die sogenannten Landesförderinstitute.
Kreditanstalt für Wiederaufbau – die Ursprünge der KfW
Der ursprüngliche Zweck der KfW steckt in ihrem Namen: Die Kreditanstalt für Wiederaufbau wurde gegründet, um Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufzubauen – die Kreditanstalt sollte Mittel aus dem European Recovery Plan (ERP) verwalten, besser bekannt als „Marshallplan“. Das „Gesetz über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KredAnstWiAG)“ – kurz KfW-Gesetz – trat am 18. November 1948 in Kraft, ein gutes halbes Jahr vor der Gründung der Bundesrepublik Deutschland.
Neben der Verwaltung von Mitteln und Warenlieferungen durch den Marshallplan, für Westdeutschland 1,6 Milliarden Dollar, durfte die KfW auch Schuldverschreibungen ausgeben, mit denen sie sich Geld lieh. Mit diesen Mitteln konnte sie unter anderem die Schwerindustrie der Bundesrepublik anschieben – die KfW war also ein tragender Baustein des westdeutschen Wirtschaftswunders.
Mehr als 75 Jahre später ist die KfW nicht mehr nur Verteilungs- und Förderungsbehörde, sondern agiert als echte Bank, die sich freiwillig der Kontrolle durch die Bankenaufsicht (BaFin) unterwirft. Sie hat auch schon verschiedene andere Banken übernommen, so unter anderem 1994 die ehemalige Staatsbank der DDR und 2003 die Deutschen Ausgleichsbank (DtA).
Vorreiter Hamburg; So gelingt die Wärmewende
Meine Zustimmung kann ich jederzeit unter Datenschutz widerrufen.
Was genau fördert die KfW?
Die KfW fördert nach eigenen Worten Projekte, um „die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Lebensbedingungen weltweit zu verbessern”. Was heißt das im Einzelnen?
KfW-Förderung für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen
Die KfW unterstützt Unternehmen in verschiedenen Bereichen:
- Verschiedene Förderkredite für Unternehmen aus dem Mittelstand
- Förderung von Unternehmensgründungen oder die Übernahme bestehender Unternehmen als Nachfolge
- Förderung von nachhaltigen Investitionen, z. B. in Photovoltaik oder Elektromobilität
- Investitionen in digitale Infrastruktur und IT-Sicherheit, z. B. auch KI-Maßnahmen
- Förderung von Innovationsprojekten, z. B. Produktverbesserungen oder Markteinführungen
- Förderung von Investitionen in klimafreundlichen Wohnraum
Kommunen, kommunale Einrichtungen und soziale Organisationen können unter anderem in diesen Bereichen günstige Kredite beantragen:
- Bau, Kauf, energieeffiziente und barrierearme Sanierung von Gebäuden
- Einbau von neuen, klimafreundlichen Heizungen
- Maßnahmen zur Verbesserung der klimafreundlichen Mobilität, z. B. klimafreundliche Transportmittel im Personen- und Güterverkehr
- Umstellung auf nachhaltige Energie-, Versorgungs- und Entsorgungsinfrastruktur
- Digitalisierungsmaßnahmen, z. B. Ausbau des Glasfasernetzes
- Barrierefreie Gestaltung oder Schaffung von Grünanlagen in Städten und Gemeinden
- Mittel zum Betrieb von kommunalen Unternehmen und Organisationen
Für den Extra-Euro zwischendurch
Klar, Geld anlegen und Zinsen kassieren ist prima. Aber ans Festgeld kommt man im Notfall nicht heran. Ein Sparbuch bringt kaum Ertrag. Die Lösung: Das TagesGeld der Hanseatic Bank mit attraktiven Zinsen. Und trotzdem ist das Geld täglich verfügbar. Für einen Sonderwunsch – oder falls etwas mal nicht nach Wunsch läuft.

Wo unterstützt mich die KfW als Privatperson?
Auch als Privatperson kannst du vom Förderangebot der KfW profitieren. Zum Beispiel in diesen Sektoren:
- Förderkredite für den Immobilienkauf und –bau, z. B. klimafreundliche Neubauten oder von Familien genutztes Wohneigentum
- Energieeffiziente Sanierung von Wohneigentum, z. B. Dämmung, Sonnenschutz, Einbau von Photovoltaik-Anlagen, Erneuerung der Heizung
- Förderung von Unternehmensgründungen oder die Übernahme bestehender Unternehmen als Nachfolge
- Verschiedene Bildungskredite, z. B. der KfW-Studienkredit für Studium oder Promotion, Bildungskredit für Schüler*innen und Studierende im letzten Jahr ihrer Ausbildung, Aufstiegs-BAföG für Berufstätige zur Weiterbildung unter anderem für Prüfung und Meisterstück.
War der Inhalt für dich hilfreich?
Teile den Artikel:




